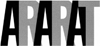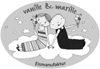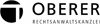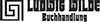Mai 2025 - Ausgabe 269
 |
Kreuzberger
Hannelore Mühlenhaupt Ich brauche Stadt und Land und ich kann beides 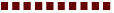
von Edith Siepmann
|
|
|
|
Die offene Einfahrt der Fidicinstraße 40 führt in einen langgestreckten Hof mit niedrigen Ziegelsteinremisen. Es tönt ein Horn, eine Säge kreischt auf. Dann wieder Stille und das Summen von Bienen. Gänseblümchen schauen zwischen Asphalt und Pflaster hervor. Eine fast ländlich anmutende Idylle mitten in Kreuzberg. Vor der Tür des Kurt Mühlenhaupt Museums sitzt eine Frau in rotem oder grünem, manchmal blauem Pullover und blinzelt durch eine rote, manchmal weiße Brille in die Frühlingssonne. Neben ihr mit ähnlich weißen Kurzhaar-Locken ein freundlicher Schnauzermischling. »Das ist Fritzi, meine Fitnesstrainerin. Ich würde am liebsten morgens liegen bleiben und dauernd essen, aber mit Fritzi – keine Chance!« Man glaubt es ihr nicht, denn Hannelore Mühlenhaupt, die Witwe des »Malers der Liebe«, der die Kreuzberger so krummbeinig wie liebenswert und lebendig in Öl konserviert hat, ist eigentlich immer in Bewegung. Beschäftigt mit dem umfangreichen Nachlass von »Kurtchen« und dem Aufbau des Museums, das ganz im Sinne des Malers ein Kultur- und Nachbarschaftsort geworden ist. Vor fünf Jahren hat Hannelore ihren Hof im brandenburgischen Bergsdorf »an einen Chinesen« verkauft und ist mit Kurtchens Bildern zurück nach Kreuzberg gezogen, zurück vom Land in die Stadt. 
Hannelore Mühlenhaupt in Bergsdorf - Foto: Chris Frey
Hannelore, die älteste, ging im nahen Steinbach mit 10 anderen Kindern in eine der beiden Dorfschulklassen. »In der Stadt wäre ich mit meiner Legasthenie untergegangen, aber hier war ich dann die Einzige, die nach Nürnberg ging und Abitur machte. Das schlechteste in Bayern!« - »Hannelore, Du bist wohl was Besseres?« schrie man ihr im Dorf nach. »Ja, bin ich!«, antwortete sie. »Hannelore, glaabst das d´an Mann kriegst, wo Du Französisch lernst und ned kochn?« riefen die Alten. »Ja, mit Französisch, das glaub ich schon!« Der Dorf-Skandal war da. »Ordinär!« Aber sie ließ sich nicht verunsichern, sie war die Coolste überhaupt. Und wusste früh, dass Bildung frei macht und »Grün nur was für Kühe« ist. Das Abitur war der Weg, ihre Sehnsucht nach der Welt zu stillen: Sie wollte raus aus dem Dorf in die Städte. Es war das Jahr 1968, klassische Bildung war nicht ihr Ding, sie träumte eher »von langhaarigen, Ho Chi Minh- rufenden Jünglingen« und ging zum Philosophie- und Psychologiestudium nach Regensburg. Bald merkte sie, dass es ihr als Legasthenikerin zu schwer würde, lange Texte »in die Schreibmaschine zu hacken«. Heute, mit PC und Korrekturprogrammen, wäre sie wahrscheinlich »eine von der schreibenden Zunft geworden«. Damals entschloss sie sich, auf Naturwissenschaften umzusatteln. »In Physik waren die interessantesten Jungs, aber für Mädchen kein Platz. Also Pharmazie.« Berlin, Hamburg, München – da wollte sie hin, aber sie musste nach Bonn. Spießig war es dort, voller schlagender Verbindungen. Also machte sie schnell ihren Doktor - »in Berlin wäre ich heute noch nicht fertig!«, und zog drei Jahre in einem anthroposophischen Krankenhaus in Herdecke durch. Keine Perspektive für sie: »Ich habe mit allen Leuten, die fundamentalistisch sind, Probleme. Zuviel Birkenstock, Anthroposophen-Knödel, zu verbiestert.« Sie wechselte nach Köln zur Drogenberatung. Als sie einer drogensüchtigen Mutter eine Watschen gegeben hatte, weil die den von Hannelore geschenkten Ghettoblaster ihres Sohnes verdealt hatte, wurde ihr klar, »das ist nichts für mich.« Es fehlte ihr die nötige Distanz. Endlich Umzug nach Berlin! Kreuzberg, Fichtestraße. Doch auch auf ihrem neuen Arbeitsplatz, einer alternativen Apotheke in Gropiusstadt, war es ihr zu dogmatisch und intolerant. Sie entschloss sich, mit Medico International auf die Kapverden zu fahren. »Die suchten Leute, die da eine Fabrik für billige Medikamente aufbauten. Ich wollte schon immer die Welt retten.« Der dreimonatige Vorbereitungskurs dafür sollte im Deutschen Entwicklungsdienst in Kladow stattfinden. Nun überschlugen sich schicksalhafte Ereignisse. Ihre Nachbarin und Freundin Uschi, mit der sie um die Häuser zog, schwärmte ihr von Kurt Mühlenhaupt vor, den sie aus Leierkasten-Zeiten kannte. Als Uschi 1981 nach Besuch der Kreuzberger Festlichen Tage auf der Kreuzbergstraße von einem Betrunkenen überfahren wurde, überlegte Hannelore, dem Maler die schlimme Botschaft vom Tod der Freundin zu überbringen. Sie wusste von ihr, dass Mühlenhaupt mit seiner Familie in Kladow wohnte, wo er nach dem »Wegsanieren« aus Kreuzberg einen renovierungsbedürftigen Hof gekauft hatte. Mit ihren roten Hennalocken stand sie am Gartentor. »Ihr rötlich gekräuseltes, langes Haar schimmerte und sprühte. Ihre Bäckchen waren gerötet. Und so komisch nun alles klingen mag, trotz dieser traurigen Nachricht, ahnte ich, dass wir beide füreinander bestimmt waren«, so der Maler in seinen Memoiren. Es war Prickeln auf den ersten Blick. Hannelore lakonisch: »Gut, dass ich dann dort den Kurt kennen gelernt habe, sonst hätte ich heute wahrscheinlich AIDS.« 
Foto: Privatarchiv
Schon morgens um 10 Uhr standen »alle Schluckspechte und Lebenskünstler« in der Werkstatt. Hannelore war der Zerberus und sprach Bierverbot im Atelier aus. »Wir machen jetzt Mittagsschlaf«, war eine häufige Abfuhr. »Ehrlich, hast Du Lust, immerzu mit angetrunkenen Leuten zusammen zu sitzen? Und das Schlimmste: Die erzählen immer dasselbe.« Bei einigen galten sie nun als Spießer, »die wahre Bohème war die versoffene Bohème.« Kurt kam trotz ihres strengen Regiments nicht zum Arbeiten. Im Leierkasten hatte er gesehen, wie Alkoholismus zerstört. Er selbst förderte den Mythos vom kreativen Trinker, hatte aber als Hypochonder Angst vor den Folgen. Er trank wenig, rauchte nicht mehr, das halbvolle Bierglas war schon in den 60ern Deko. Zur harten körperlichen Arbeit der Wohnungsentrümpelungen und dem nächtlichen Malen passte der tägliche Rausch nicht. Viele Schicksale taten Hannelore leid. »Da gab es einige talentierte Künstler, die durch den Alkohol untergingen.« Sie machte Sozialamtsgänge für Artur, Rosi und Carol, suchte Wohnungen und brachte Suppe. Es kam die Wende, sie trafen alte Ost-Freunde auf dem Land und entdeckten ein heruntergekommenes Barock-Ensemble. Kurt sah die Ruine und kaufte. Den Kreuzberger Hof vermieteten sie an Theater und Künstler. Bis das Herrenhaus fertig war, wurde im Zelt und Kälberstall übernachtet. Und Kurt und Hannelore schlossen nach 15 Jahren wilder Ehe den Bund fürs Leben. »Sie ist der Stern meines Lebens«, ist in seinen Reisebeschreibungen zu lesen. 
Foto: Chris Frey
Seit fünf Jahren lebt Hannelore wieder in Kreuzberg. Und wundert sich immer wieder. »Naja, in Kreuzberg herrscht schon ein geschlossenes Weltbild.« Ihr gestorbener großer, schwarzer Hund hieß Othello, »ein no-go. Im Viktoriapark wurde ich angemacht, wie ich einen schwarzen Hund Othello nennen kann! Dabei hieß der gar nicht wegen seinem Fell so, sondern weil er so eifersüchtig war. Aber das kann man dem Kreuzberger nicht erklären. Doch neulich hab´ ich gesehen, wie einer auf dem Mittelstreifen vom Mehringdamm Yoga gemacht hat. Das fand ich interessant.« Inmitten von Bildern, Theatern, Werkstätten, Studios und Ateliers wohnt Hannelore und arbeitet mit ihren Mitarbeiterinnen Christina, Victoria, Barbara und Yaissa am Museum als Ort der Begegnung. Es war nicht einfach, den Künstlern in ihren Ateliers zu kündigen, aber »der Kurt hat auch ein Recht mit seinen Bildern. Und wenn wir den Hof nicht gekauft hätten, wären hier heute gar keine Künstler mehr, sondern nur noch Luxuswohnungen wie in der Bockbrauerei gegenüber oder im Viktoriaquartier.« Als nächstes will Hannelore ein Museumscafé eröffnen. Das Klassik-Plattenlager muss erst raus. Hat sie etwas von der dominanten Mutter geerbt? »Na, halbdominant bin ich wahrscheinlich schon, was Du in Kreuzberg auch sein musst. Da kommst Du als Hausbesitzer gleich nach den Kinderschändern.« Hoch über allem schwebt Kurtchen. »Morgens im Bett schreit er mich schon an: Jetzt steh mal auf und mach an der Ausstellung weiter! - Ich sag ihm: Du hast mir nichts zu sagen. Da lacht er nur. Ich frage mich, ob Tote noch erziehungsfähig sind?« Doch dann steht sie halt auf, Fritzi wartet ja auch schon, und der Tag beginnt. »Man kann nichts Besseres erben als eine Aufgabe.« Es ist ein kleiner Kosmos entstanden für Begegnungen, mit Opernsängern, Tangotanz, einer Druckwerkstatt, Diskussionsabenden, Kindergeburtstag, Klavierkonzert und Lesungen. Im Gästebuch der aktuellen Ausstellung »Kreuzberger Blüten« liest man: »Hier ist Heimat in unheimlicher Zeit«. An den Wänden Gemälde der jungen Anna Nezhnaya und des alten Kurt Mühlenhaupt, dabei ein Mohnblumenbild neben einer »Frau im roten Kleid«. Davor im Hof auf grauem Pflaster sitzt Hannelore. Gelb scheint die Sonne auf ihren blauen Pullover. |