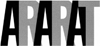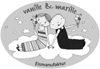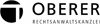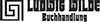März 2025 - Ausgabe 267
Straßen, Häuser, Höfe
|
Lichterfelder Straße Nummer 4 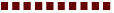
von Dietmar Brunner |
|
|
|
Das Kreuzbergurteil Dass die Wellen so hoch schlagen würden und dass unter Juristen noch 100 Jahre später über die Ablehnung einer Baugenehmigung in der Nähe des Kreuzberges debattiert werden würde, damit hatte das örtliche Polizeipräsidium sicher nicht gerechnet. Die Männer auf der Wache hatten getan, was sie für ihre Pflicht gehalten hatten und einem Spekulanten, der die beiden Baugrundstücke Nr. 4 & 5 an der Lichterfelder Straße erworben hatte, um vierstöckige Mietshäuser zu errichten, die Baugenehmigung versagt. Die Begründung lag in einer polizeilichen Verordnung vom 10. März 1879, die besagte, dass Gebäude in der näheren Umgebung des Nationaldenkmals auf dem Kreuzberg »fortan nur in solcher Höhe errichtet werden, dass dadurch die Aussicht von dem Fuße des Denkmals auf die Stadt und deren Umgebung nicht behindert und die Ansicht des Denkmals nicht beeinträchtigt wird.« Um die freie Sicht auf die Stadt zu ermöglichen, hatte man erst ein Jahr zuvor den Sockel des Kreuzbergdenkmals mit Mitteln aus Steuergeldern noch einmal um einige Meter angehoben, weshalb der Einspruch der Polizeibehörde logisch erschien. Drei Jahre später jedoch widersprach das Verwaltungsgericht der Polizei und gab dem Bauunternehmer Recht. Das Urteil hatte weitreichende Folgen nicht nur für die Entscheidungsbefugnisse der Polizei, sondern für die künftige Stadtentwicklung allgemein. Wer heute vor Schinkels Denkmal auf dem Kreuzberg steht, dem ist der Blick nach Süden über das Tempelhofer Feld bis weit nach Brandenburg durch die erst in jüngster Vergangenheit entstandenen Bauten des Viktoria-Quartiers versperrt. Bau-genehmigungen dieser Art sind erst nach dem Kreuzbergurteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 14. Juni 1882 möglich. Der Sieg des Kreuzberger Spekulanten war ein Sieg der Immobilienwirtschaft über die Stadtbevölkerung. Dennoch fanden auch die systemkritischen Jurastudenten der Achtundsechzigerjahre lobende Worte für das Eingreifen des Verwaltungsgerichtes. Das Kreuzbergurteil markiere den Übergang vom Polizeistaat zum Rechtsstaat. Die Möglichkeit der zuständigen Polizeibehörden, »in jedem einzelnen Baufalle« willkürlich entscheiden zu können, habe zu »einem völlig schrankenlosen Ermessen der Polizeibehörde« geführt. Es sei fragwürdig, ob die Polizeiverordnung zum Schutze des Denkmals auf dem Kreuzberg »mit den Gesetzen im Einklang stehe«, denn es widerspreche dem Grundsatz »der Unverletzlichkeit des Eigentums.« Bis heute ist dieser in den Gesetzen verankerte Schutz des Privateigentums zu Ungunsten des Gemeindebesitzes die Krux in der städtebaulichen Entwicklung und der Grund für die Verunstaltung der Städte durch hässliche Betonbauten. Die Klage des Bürgers über die Beschneidung seiner Eigentumsrechte eskalierte zum Machtstreit zweier staatlicher Institutionen: den Polizeibehörden und der Exekutive einerseits und den Gesetzgebern und der Legislative andererseits. War es dem »Rentier M.« lediglich um den Verlust seines möglichen Profits und den Schutz seiner kleinbürgerlichen Interessen gegangen, wurde jetzt landesweit diskutiert, wer im Staat das Sagen hat. Als das Gericht feststellte, dass die Baupolizei ihre Befugnisse überschritten habe, da sie sich lediglich um die »Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung« zu kümmern habe, protestierte diese, man wolle der Polizei nur noch »die Befugnis zugestehen, das Publikum vor Gefährdungen des Lebens, der Gesundheit und des Eigenthums zu schützen.« Doch das zu schützende »Gemeinwesen« besitze noch viele andere und namentlich ideelle Güter, »welche des behördlichen Schutzes gegen die Handlungen einzelner Mitglieder des Staates bedürften.« Die Anwälte des Verwaltungsgerichtes aber waren der Ansicht, dass die Verteidigung des Gemeindeeigentums ebenso wenig zum Aufgabenbereich der Polizei gehöre wie Maßnahmen gegen »Störungen einer architektonischen Harmonie« oder ein »Mehr oder Minder an freier Aussicht«, woraufhin die Polizeibehörde klarstellte, dass der Schutz des Gemeinwesens keine willkürliche Maßnahme, sondern im Landesrecht verbrieft sei, und dass das umstrittene Bauprojekt »zum Schaden des gemeinen Wesens als auch zur Verunstaltung der Stadt gereichen würde.« Das Gericht wiederum konterte, dass die Polizeiverordnung vom 10. März 1879 nicht »der Ausführung allgemeiner gesetzlicher Bestimmungen«, sondern der Manifestierung der Macht des Polizeiapparates hätte dienen sollen. Und ergänzte, dass besagte polizeiliche Verordnung vom 10. März generell von jedem Grundeigentümer verlange, »zum besten des gemeinen Wesens« sein Eigentum zu opfern, - »wie schwer auch immer den Einzelnen dieses Opfer träfe.« Rentier M., dessen Name seinerzeit in aller Munde gewesen sein muss, der aber stets nur als Kürzel in den Akten auftaucht, errichtete die beiden letzten Häuser auf der Westseite der Lichterfelder Straße. Beide Häuser stehen noch, doch die Lichterfelder Straße ist verschwunden. Sie heißt heute Methfesselstraße. Auch auf der anderen Straßenseite entstanden Mietshäuser, unter anderem das Haus mit der Nummer 7, in dem Konrad Zuse den ersten Computer der Welt zusammenschraubte. Eine kleine Tafel an der altersschwachen Ziegelmauer erinnert bis heute an ihn. Auch an den Rechtstreit und das Kreuzbergurteil erinnert ein Stück entfernt am Eingang zum Viktoriapark heute noch eine Gedenktafel. 
Blick von der Großbeerenstraße zum Kreuzberg, 1887, Albert Schwarz, © Kreuzbergmuseum - Foto: A. Schwarz
|