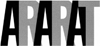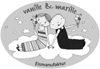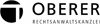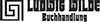März 2025 - Ausgabe 267
 |
Kreuzberger
Werner Schneidewind Ich bin eben ein Querkopf 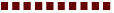
von Hans Korfmann
|
|
|
|
Er steht da, jeden Tag, an derselben Stelle, von mittags um Zwölf bis abends um Sieben. »So etwa. Ich habe flexible Arbeitszeiten!«, sagt Schneidewind. Sonntags bleibt er zuhause, aber Kälte, Regen, Hitze, all diese Widrigkeiten des Berliner Wetters können ihn nicht abhalten. Er steht da, vor der alten Post am Marheinekeplatz, neben dem Bäcker, die bunte Strickmütze auf dem Kopf, sein »Markenzeichen«, eingepackt in eine dicke, russlandtaugliche Jacke und eine selbstgedrehte Zigarette im Mundwinkel - oder zumindest den Stummel davon. Neben sich das Fahrrad mit dem Ghettoblaster, der die Scherben spielt. Wenn Schneidewind gute Laune hat, gern etwas lauter, damit auch die drüben auf dem Friedhof etwas davon haben. Schneidewind hat oft gute Laune. Weil er seine Arbeit gerne macht. Weil er sie aus Überzeugung macht. Er steht hinter dem Blatt, das er verkauft. Dem Querkopf. Weil er selber ein Querkopf ist. Schneidewind ist mehr als nur ein Verkäufer. Er ist ein Botschafter, er übermittelt Nachrichten, Nachrichten von unten. Für die da oben. 500 dieser Querköpfe werden jeden Monat in Kreuzberg verkauft. Ohne Schneidewind wäre das unmöglich. 
Foto: Dieter Peters
Werner Schneidewind sägte Stuhlbeine, jeden Tag, von morgens bis abends, bis die Fräse ihm zwei Finger wegfraß. Monatelang lag er im Krankenhaus und wusste nicht, was er nun anfangen sollte. Arbeit gab es für einen, dem zwei Finger fehlten, in diesem Kuhdorf nicht. Auch nicht bei Edeka. Aber es gab die Tankstelle, »ich glaube, wir haben Zigaretten geklaut oder so was. Außerdem wusste ich, wo in der Kneipe die Zigarrenkiste mit den Geldscheinen stand.« Sechs Monate war er im Gefängnis. Als er wieder rauskam, wechselte er die Seite und begann, sich in der Rosaroten Knasthilfe zu engagieren. Es war gut, zusammen mit anderen für etwas zu kämpfen. »Wir waren so vierzig Leute, besprühten die Busse mit linken Parolen und kümmerten uns um die, um die sich sonst keiner kümmerte.« Nebenbei kellnerte er im Bürgerzentrum in der Alten Feuerwache, zusammen mit Daniela, einer Staatenlosen, die in der Bundesrepublik zwar geduldet wurde, aber so wie er hier nie wirklich wurzeln konnte. Daniela war beliebt, »wenn die da war, war der Laden brechend voll. Als sie dann ein paar Wochen fehlte, blieben alle weg.« Auch Werner mochte sie. »Wir waren vier Jahre zusammen, und dabei kam ein Kind heraus, ein Junge.« Dann gingen die Wege wieder auseinander. Was blieb, war die politische Arbeit. Sie schrieben Parolen und Flugblätter, organisierten Demonstrationen und gaben einmal im Monat das Kölner Volksblatt heraus. »Das war ein Zusammenschluss von 15 verschiedenen Initiativen, gar nicht schlecht.« Doch nicht nur auf Zeitungspapier, Bussen und Transparenten verkündete Schneidewind seine Meinung, er malte sie auch mit Kreide aufs Straßenpflaster. Die Bilder des Pflastermalers gehörten irgendwann zum Straßenbild, die Leute blieben stehen und sahen ihm zu. Eines Tages stand da Elena. Elena war eine junge Frau. »Dabei kam dann eine Tochter heraus.« Aber auch das mit Elena hielt nicht ewig, irgendwann stand er wieder alleine auf der Straße und verkaufte die Kölner Obdachlosenzeitung. Er verkaufte sie nicht nur, Schneidewind fehlte auf keiner Redaktionssitzung. Querkopf hieß das Blatt, es gab Sonderausgaben mit Gedichten von Obdachlosen oder Themenschwerpunkten wie dem Bedingungslosen Grundeinkommen. Als Klaus, der Chef, ihn eines Tages fragte, ob er nicht Lust habe, in Berlin eine Zweigstelle zu eröffnen, überlegte Schneidewind nicht lange. Denn Elena hatte sich gemeldet! Aus Berlin. Die gemeinsame Tochter wolle ihren Vater kennenlernen. Also fuhr er zu Elena nach Prenzlauer Berg und zog abends mit seinen Querköpfen durch die Kneipen. »Die Ossis haben mich unterstützt, die fanden das gut und haben mich weiterempfohlen. 1999 war Prenzlauer Berg ja noch intakt.« Aber auch der zweite Versuch mit Elena misslang. Glücklicherweise wurde in der Blücherstraße in Kreuzberg gerade eine Ladenwohnung frei. »Da war dann unsere Redaktion. Geschlafen habe ich erst mal auf einer Liege im Keller. Nach anderthalb Jahren bot mir die Hausverwaltung eine Zweizimmer-Wohnung in Neukölln an. Die Verwaltung war in Ordnung. Ich wohne heute noch da.« Aber die Blücherstraße wurde verkauft, gleich drei Mal. Auch die Hausverwaltung wechselte. »Wir waren die ersten, denen gekündigt wurde.« Natürlich hat Schneidewind protestiert, Flugblätter gedruckt gegen Gentrifizierer und Kapitalistenschweine. Schneidewind muss seine Meinung sagen. »Aber wir hatten keine Chance.« 
Die Blücherstraße 37 gibt es nicht mehr. Aber Schneidewind gibt es noch. Er steht vor der alten Post. Seine Stammkundschaft hält ihm die Treue, obwohl das Postamt seit Jahren geschlossen hat. Schneidewind hat »massive Einbußen« verbuchen müssen seitdem, aber es geht ja nicht um die zwanzig Euro, die er da verdient. »Früher wäre ich für zwanzig Euro nicht mal aufgestanden.« Es geht darum, seine Meinung zu sagen. Schneidewind ist Aktivist. Wenn dieser Friedrich wieder so einen dämlichen Spruch loslässt über die Faulenzer und »Sozialschmarotzer«, die nicht arbeiten wollen, dann bekommt Werner einen dicken Hals. Und wenn der Friedrich das dem Werner ins Gesicht sagen würde, der hier jeden Tag steht von 12 bis 19 Uhr, für 20 Euro, seit 20 Jahren, in seinem Alter, mit seinen 73 Jahren und dieser mickrigen Rente - er würde dem Friedrich die Ohren lang ziehen. Aber der Friedrich kommt nicht. Dafür kommen die rechten Querdenker und glauben, der Querkopf sei einer von ihnen. Dann deutet Schneidewind mit einem seiner acht Finger auf die Titelseite, und da steht: Ausgabe Nr. 325. Und fügt hinzu: »Als wir mit der Zeitung angefangen haben, da gabs Euch doch noch gar nicht.« Schneidewind wird hier stehen bleiben. Er hat seinen Platz gefunden, sich gewöhnt an die Plaudereien mit den Nachbarn über Politik, an den Kaffee aus der Bäckerei und an den Filialleiter, der ihm manchmal ein Brot schenkt. Schneidewind wird reden, solange er reden kann. Schneidewind redet gerne, viel und gut. Manchmal aber schweigt er auch: »In letzter Zeit fragen sie mich öfter, ob ich Deutscher bin. Und wenn ich nicke, sagen sie: Gut, dann kriegen Sie auch was von mir!« Schneidewind steckt das Geld ein. Schweigend. »Ich wär doch blöd, wenn ich das nicht einstecken würde. Geld stinkt ja nicht.« Aber wenn Leute kommen und ihm sagen, da drüben um die Ecke würden wieder Ausländer stehen und ihm das Geschäft ruinieren, dann sagt er: »Das geht Sie gar nichts an. Das ist mein Geschäft, nicht Ihres.« Die Ausländerfeindlichkeit nehme zu, sagt er, auch in Kreuzberg. Kürzlich, beim Bäcker, habe ein Kunde angesichts der indischen Verkäuferin entrüstet den Laden verlassen, bei Ausländern kaufe er nichts. »Vor zehn Jahren hätten die Kreuzberger den noch verdroschen!« Schneidewind steht auf der Straße, jeden Tag, die Menschen und die Jahre ziehen vorüber. Er sieht ihnen zu, hört zu, denkt nach. Manchmal schreibt er etwas auf. In seiner Zeitung. Er ist immer da. Nur wenn der Ostwind weht, dann stellt er sich um die Ecke vor den Buchladen. Die sind auch nett, »die vom langen Blomqvist«. Da verkauft er auch mehr. Aber darum geht es ja nicht. Seinen Stammplatz vor der Post wird er nicht verlassen wegen ein paar Euro mehr oder weniger. »Ich bin eben ein Querkopf.« |