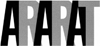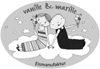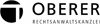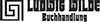März 2025 - Ausgabe 267
Geschichten, Geschichte, Gerüchte
|
Der Dustere Keller im Roman 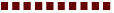
von Christoph Hamann |
|
|

Eine Geschichte von der Revolution Romane erzählen Geschichten. Manchmal beruhen sie auf wahren Begebenheiten, manchmal sind sie frei erfunden. Und manchmal sind sie eine Komposition aus beidem, Dichtung und Wahrheit. Soweit, so bekannt. Auch Friedrich Spielhagen hat 1861/62 in seinem Roman Problematische Naturen eben diesen Weg gewählt und historisch Verbürgtes mit frei Erfundenem vermischt. Sein Thema: der Gegensatz zwischen Adel und Bürgertum und die Revolution von 1848. Das Buch wird von Literaturwissenschaftlern gerühmt, von Lesern aber selten in die Hand genommen. Das liegt womöglich auch an seiner Länge: Erst nach rund 700 Seiten und etlichen Liebesaffären beginnt die Handlung sich dramatisch zuzuspitzen. In diesem Werk taucht ganz unverhofft plötzlich auch der Kreuzberg auf, genauer gesagt: der Dustere Keller. Das historisch verbriefte Lokal am Fuße des Kreuzbergs wird von manchen in der Nähe der späteren Arndt- und Nostitzstraße vermutet, von anderen am heutigen Mehringdamm auf Höhe des Familienzentrums. Die Wirtschaft war 1810 eröffnet worden, Friedrich Ludwig Jahn und Friedrich Friesen, nach denen später zwei nahegelegene Straßen benannt wurden, kamen nach dem Turnen in der Hasenheide im Dusteren Keller vorbei, zechten und sorgten für patriotische Stimmung gegen Napoleon. Spielhagen erweckt seine Roman-Wirtschaft am Vorabend der Revolution vom 18. März 1848 zu prallem Leben. Die Bude ist voll, das Bier schmeckt, die Schankmädchen Elise, Pauline und Bertha schäkern mit den Gästen und füllen die Krüge fleißig nach. Der spätere Barrikadenheld, Zirkusdirektor Kaspar Schmenckel, hält alle Gäste für »Demokraten reinsten Wassers«. Bärtige Gesellen, die beim Bier politisieren und auf die »verrotteten Zustände, die schändliche Polizeiwirtschaft und die vertierte Soldateska« schimpfen. Rosalie Pape, die Wirtin - eine »falsche Katze«, so Elise - betreibt nebenher und verdeckt ein lukratives Geschäft als Kupplerin. Sie vermittelt jungen Adeligen junge Frauen auf Zeit – eine Art Escort-Service anno 1848 also. Für nicht geplante Nebenfolgen dieser diskreten Arrangements weiß sie ebenfalls Rat und Tat, schließlich war sie selbst als Dienstmädchen einst die Geliebte eines Barons gewesen. Rosalie pflegt zudem Vertraulichkeiten zu einem Herrn von der Geheimpolizei, der von alldem weiß und dies selbstredend deckt. Der wiederum ist verbandelt mit einem im Dusteren Keller bechernden Bösewicht, der die adelige Herrschaft mit seinen Kenntnissen über außereheliche Amouren von einst und deren heute erbberechtigten Söhnen erpressen will. Der Dustere Keller im Roman ist ein Treffpunkt jenseits bürgerlicher Konventionen, ein Ort inmitten der vorrevolutionären Gesellschaft, wo deren Regeln nichts galten. Am 18. März bauten die Berliner, Männer und Frauen, Kinder und Alte, Arbeiter, Gesellen, Handwerker und einige wenige Bürgerliche überall in der Mitte Berlins Barrikaden. »Und die Büchsen der Barrikadenverteidiger krachten, und Steine prasselten von den Dächern auf die Köpfe der unglücklichen Soldaten herab, und als der Rauch und Staub sich verzogen, sah man die Kompagnie, die in kriegerischer Ordnung heranmarschiert gekommen war, in wilder Verwirrung sich wieder zurückziehen, voraus ein reiterloses Pferd und zwischendurch kleine Truppen von drei, vier Mann, die Tote oder Verwundete eiligst aus dem Bereiche der Barrikade trugen. Von den Männern des Volkes war nur einer, und selbst der durch keine feindliche Kugel verwundet.« Schmenckel, ein Hüne an Gestalt, erschießt tragischerweise seinen unehelichen Sohn, den Fürsten Waldernberg, der als Offizier just jenes Bollwerk mit seinen Soldaten stürmen wollte. Schließlich sollte eine List den Erfolg bringen. Rosalie öffnet dem Bösewicht und dem Polizeiinformanten in einem tiefer liegenden Vorratsraum eine Hintertür, durch die das Militär einzudringen versucht. Es kommt zum Gemetzel zwischen diesen und den von Elise gewarnten Barrikadenmännern. Der Bösewicht bleibt mit zerschmettertem Schädel auf der Strecke, ein Soldat hatte sich unglücklich selbst das Bajonett in den Leib gerammt. Romane erzählen Geschichten. Spannend ist Spielhagens Darstellung des Kampfes. Sie nimmt gleich mehrere Kapitel ein und hält sich, nach allem, was man weiß, bei dieser Schilderung auch getreu an die historischen Ereignisse. Allerdings ist Spielhagen durchaus einseitig, man erkennt deutlich seine Perspektive als Autor aus dem fortschrittlichen Bürgertum. In seinem Roman sind die Helden des Kampfes - von Schmenckel einmal abgesehen - ein Baron, ein Professor und ein Intellektueller, der das verleugnete Kind eines Aristokraten zu sein scheint und als melancholischer Liebhaber mehrerer Frauen und als eine charakterlich »problematische Natur« beschrieben wird. In der Realität von 1848 kamen die Revolutionäre aus unterbürgerlichen Schichten. Auch wurde im historischen Dusteren Keller am Kreuzberg nie gekämpft, lag er doch eine gute Wegstrecke vor dem Halleschen Stadttor und nicht in der umkämpften Stadtmitte. Allerdings könnte der Autor dem wirklichen Dusteren Keller durchaus einen Besuch abgestattet haben. Schließlich gab es 1848 bereits einen »Omnibus« zum Kreuzberg, und so könnte es also auch sein, dass eine echte Elise, eine Pauline oder Rosalie Modell stand für die Romanfiguren, und dass die Beschreibung der Gesellschaft in der Wirtschaft am Kreuzberg gar nicht so weit von der Wahrheit hergeholt wurde. Auch wenn Romane eigentlich nur Geschichten erzählen. |