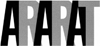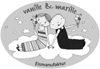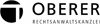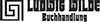Februar 2025 - Ausgabe 266
Straßen, Häuser, Höfe
|
Teltower Straße 1-4 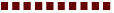
von Werner von Westhafen |
|
|

Gesellen, die mit einem Stock und einem Kleiderbündel durchs Land zogen, gab es schon in Grimms Märchen. Den gesetzlich verbrieften Gesellen aber, der bei einem Meister seine Ausbildung machte und vor einer staatlichen Prüfungskommission zu bestehen hatte, gab es damals noch nicht. Erst 1897 wurde das so genannte »Handwerkergesetz« verabschiedet, das die Ausbildung von Handwerksgesellen und die Gründung von Meisterbetrieben regelte. Die Statuten wurden von Mitgliedern verschiedener Handwerkergilden und Sekretären Kaiser Wilhelms II. erarbeitet, der mit Sorge zur Kenntnis genommen hatte, dass der internationale Ruf des deutschen Handwerks in Verruf geraten war. »Made in Germany« war Ende des 19. Jahrhunderts kein Qualitätssiegel, sondern ein internationales Synonym für mangelhafte Ware. Die neuen Regelungen veranlassten die unterschiedlichsten Berufsstände - Zimmermänner, Bäcker, Schlosser, Seiler, Tapezierer, Uhrmacher, Elektriker - sich zusammenzusetzen und eine Vertretung für ihre gemeinsamen Interessen zu wählen. Am 1. April des Jahres 1900 wurde deshalb eine so genannte Handwerkskammer gegründet. Wenige Monate später gab es landesweit bereits 71 solcher Kammern, die größte in Berlin. Hier waren 70.000 Handwerksbetriebe ansässig. Die Räumlichkeiten, die man in der Neuen Friedrichstraße 47 angemietet hatte, um in verschiedenen Büros »Auskünfte jedweder Art« zu erteilen, waren bald zu klein für die vielen Fragen und den regen Zulauf der Handwerker. Deshalb wurde am 20. März 1907 beschlossen, »ein eigenes Dienstgebäude für die Handwerkskammer zu errichten«, in dem Räume für Schulungen, Ausstellungen und Versammlungen und, »falls finanziell möglich, auch geeignete Restaurationsmöglichkeiten eingerichtet werden sollen.« Bereits drei Jahre später befand sich im imposanten Hauptgebäude der Handwerkskammer in der Teltower Straße ein Restaurant mit 400 Plätzen! Die 17. ordentliche Vollversammlung der Handwerkskammer hatte beschlossen, zum Preis von 1.100 Mark ein großes Eckgrundstück in der Nähe des Halleschen Tores zu kaufen: Die Belle-Alliance Straße 5 und »die Teltower Straße 1 bis 4 der Großkopfschen Erben.« Mit dem Abbruch der vorhandenen Gebäude sollte sofort begonnen und der Neubau »unverzüglich in Angriff genommen werden.« Man hatte Großes vor. Das Haus am Eck sollte keine Ansammlung von Büros, Auskunftsstellen und Sitzungssälen werden, sondern den ehrenvollen Stand des Handwerks repräsentieren und mit einer Bibliothek und einem öffentlichen Lesesaal ausgestattet werden, mit Schulungsräumen und großen Veranstaltungssälen. Tatsächlich müssen die Berliner gestaunt haben, als hinter den 100 Meter langen Baugerüsten die Fassaden mit ihren hohen Fensteröffnungen im Haupthaus an der Teltower Straße zum Vorschein kamen, zu beiden Seiten von stattlichen Wohnhäusern flankiert. Die Ecke zum Mehringdamm zierte ein Turm mit drei rundumlaufenden Balkonen, vor den Erdgeschossen beschatteten Marquisen von Ladengeschäften das Trottoir. Das Haus war der Stolz der Handwerkergesellschaft. Im Keller der Nebengebäude befanden sich Kegelbahnen, in der ersten und zweiten Etage Büro- und Geschäftsräume, in den Etagen darüber stattliche Wohnungen. Im zentralen Hauptgebäude lagen die so genannten Kammersäle und das Restaurant, dessen Wände eine erhöhte Estrade zierte. Die erste Etage enthielt zur Straßenfront gelegen den prachtvollen Cäcilien-Saal, im langgestreckten Hintergebäude gab es weitere kleine Säle mit Bühnen und umlaufenden Podesten. »Getrennt wurden die durch zwei Stockwerke gehenden Räumlichkeiten durch einen Renaissance-Saal«, der beiden Veranstaltungssälen als Vorraum diente und einen weiteren Restaurationsbetrieb enthielt. »Über diesem befand sich die große Garderobe für den Hauptsaal. (...) Der große Saal war mit 2000 Sitzplätzen beinahe so groß wie die Alte Philharmonie in der Bernburger Straße. Hinzu kamen über mehrere Stockwerke und die verschiedenen Häuser verteilt zahlreiche Räume für Prüfungen und kleinere Veranstaltungen. Das Haus glänzte wie kein anderes an der Belle-Alliance. Doch vier Jahre später begann der erste große Krieg, und kaum war wieder Frieden eingekehrt im Land, begann ein österreichischer Immigrant damit, den nächsten Krieg vorzubereiten. Schon 1932 war die Handwerkskammer von Nationalsozialisten unterwandert, 1933 verlor sie ihre Unabhängigkeit und wurde von der Reichswirtschaftskammer übernommen. Zum Ende des Krieges bot das Haus an der Belle Alliance einen traurigen Anblick: Vom Hauptgebäude mit den berühmten Kammersälen war nur noch die fensterlose Fassade geblieben. Die Belle Alliance und Teltower Straße sind der Obentrautstraße, dem Blücherplatz und dem Mehringdamm gewichen. Auch das beeindruckende Eckhaus steht nicht mehr, obwohl es drei Jahre nach Kriegsende samt Turm und Balkonen wiederhergestellt wurde. Doch als der Senat in den Siebzigern mit der Kahlschlagsanierung begann und alles abriss, was den Plänen moderner Architektur und Verkehrsplanung im Wege stand, musste auch der Stolz der Handwerkskammer einem modernen Neubau am heutigen Blücherplatz weichen. Ohne Restaurant, Balkone, von Marquisen überdachte Geschäfte, und ohne die Kammersäle. |