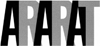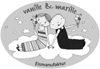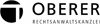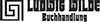Februar 2025 - Ausgabe 266
Reportagen, Gespräche, Interviews
|
Vom Rondell zum Mehringplatz 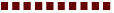
von Michael Unfried |
|
|

Er sollte, ähnlich wie der Leipziger, der Potsdamer und der Pariser Platz am Brandenburger Tor, der Stadt zur Zierde gereichen: der vor dem Halleschen Tor 1734 erbaute Platz, nachempfunden keiner geringeren als der römischen Piazza del Popolo. Die zweistöckigen Häuser, die das Rondell umstanden, waren für wohlhabende Bürger gebaut worden, doch am Ende zogen vor allem Handwerker dort ein, Einwanderer aus Frankreich, die zum Entsetzen Friedrich I. eimerweise ihre Notdürfte auf seinem Vorzeigeplatz entleerten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts zog eine feinere Gesellschaft in die inzwischen vierstöckigen Häuser am Platz, der seit der siegreichen Schlacht von Waterloo den Namen Belle-Alliance-Platz trug. Wo einst die Stadtmauer und die beiden Zollhäuschen gestanden hatten, erhoben sich nun zwei stattliche Türme mit Säulengängen und Geschäftsarkaden. Straßenbahngeleise umkreisten das Areal, in dessen Mitte seit 1840 auf der Friedenssäule ein Engel namens Viktoria die Flügel ausbreitete. 
1946 hatten auch die Stadtoberen offensichtlich genug von Sieg und Niederlage und gaben dem Belle-Alliance-Platz den klanglosen Namen Franz Mehrings. Ein Vierteljahrhundert später wurden vom Stararchitekten Hans Scharoun Neubaupläne vorgelegt, die an die his-torisch niedrige Bebauung des Rondells erinnerten und eine »bewohnbare Stadtlandschaft« im Grünen schaffen sollten. Scharoun und sein Nachfolger durften bauen, doch ihre Vision vom Platz als einer Art Vorgarten für Stadtbewohner hat sich nicht verwirklicht. Im Gegenteil, Uppstall Kreuzberg schrieb: »Das Dilemma der Stadt-entwicklung im Nachkriegs-Berlin lässt sich am Beispiel Mehringplatz und Blücherplatz besonders gut ablesen. Zerstörungen aus der noch frischen, unrühmlichen Vergangenheit wurden einfach als Status Quo gesetzt und Teile der historischen Infrastruktur bewusst überplant. Der stadtmorphologisch ‘Reine Tisch‘ wurde als Chance gesehen, gesellschaftspolitische Visionen großräumig in Stein und Beton umzusetzen. Jahrzehnte später wird mit dem sozialen Brennpunkt Mehringplatz im Sanierungsgebiet Südliche Friedrichstadt deutlich, dass Stadtplanung andere Wege beschreiten muss.« Denn der Mehringplatz, zunächst als Vorzeige-Sozialbau hoch gelobt, geriet zuletzt in die Schlagzeilen. Die taz schrieb 2024: »Besonders für Kinder und Jugendliche ist die Situation dramatisch. Hier kommen materielle Armut der Elternhäuser und Bildungsarmut zusammen. Die Einschulungsergebnisse sind die schlechtesten bezirksweit.« Ende 2023 beschrieben Manja Präkels und Markus Liske, die in Erinnerung an die erfolgreichen Revolten der Hausbesetzerjahre noch einmal einen Revolutionären Anwohnerrat gründeten, ebenfalls in der taz die Früchte falscher Sanierungspolitik. Sie berichteten von einem »Angriff auf ein schwules Paar mitten am Tag, Massenschlägereien zwischen arabischen Familien« und einem Obdachlosenschlafplatz, der in Flammen aufging. Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums am Platz berichtet, dass sie bei Regen Eimer im Flur aufstellen müsse und dass sich im oberen Stockwerk nur noch sieben Personen gleichzeitig aufhalten dürften. Den Kindern sei das Ballspielen verboten worden und das kostenlose Kreuzberger Spielmobil für die Kleinen käme auch nicht mehr. »Nun wird neben der menschenleeren Rasenfläche ein Stück Straße zum Spielen abgesperrt. Knie auf Pflaster statt grüner Wiese!« Dreihundert Meter weiter dagegen standen Millionen zur Verfügung für Neubauten mit Büros und Eigentumswohnungen auf dem Gelände des ehemaligen Blumenmarktes, »die sich Integrationsprojekt oder Metropolenhaus nennen und »Projekträume für die Kreativwirtschaft« bieten. Unter dem beliebten Stadtplaner-Euphemismus aktivierte Erdgeschosse wurden eine Organic Bakery, ein Lastenfahrradladen und ein Frühstücksrestaurant angesiedelt – Kimchi-Croissant mit Tomatenmarmelade und Essig-Heidelbeeren für 18 Euro. Eine No-go-Area für die armen Bewohner des südlich angrenzenden Kiezes«, schreiben Präkels & Liske. Kein Wunder, dass die Neuen für die alten Mehringplatzbewohner typische Gentrifzierer sind, die unbedingt nach Kreuzberg müssen, es aber so ruhig und sauber haben wollen wie in München. Doch die Neubauten sind Genossenschaftsprojekte, ihre Bewohner alteingesessene Kreuzberger, denen es um mehr geht als nur den Müll vor der Haustür und das Matratzenlager im Flur. »Für mich endet mein Zuhause nicht vor der Haustür. Wir wollen mitgestalten!«, sagt Gunther Hagen. Hagen war schon in den frühren Achtzigerjahren an alternativen und genossenschaftlichen Bau-und Wohnprojekten in Kreuzberg beteiligt gewesen. Er arbeitete beim Jugendamt und ist auch mit siebzig noch als Ombudsmann tätig, um in schwierigen Situationen zwischen Eltern und Amt zu vermitteln. Hagen engagiert sich für strauchelnde Jugendliche ebenso wie für seinen Kiez. Als er 2018 hier einzog, war das Rondell eine umzäunte Baustelle. Doch zehn Jahre war hier nichts geschehen, die Baustelle wurde zum Spielplatz von Kindern und Jugendlichen aus den viel zu engen Sozialwohnungen und zum Treffpunkt für Alkoholiker und Drogenabhängige. Nahe liegende Treppenhäuser mutierten zu Toiletten und öffentliche Toiletten zu Unterkünften. »Da hatte sich einer komplett eingerichtet, fehlte nur noch der Fernseher!« Solche Bilder machen deutlich: »Wir brauchen öffentliche Räume für diese Menschen.« Räume wie die der Kreuzberger Musikalischen Aktion aus der Friedrichstraße 1-4, die mit ihrem Radiosender und der Dachterrasse viele Jugendliche anzog (Vgl. Kreuzberger Nr. 69). »Seit zehn Jahren«, sagt Hagen, kämpft das Jugendzentrum gegen die Schließung durch den Senat. Inzwischen belaufen sich die Sanierungskosten auf 22 Millionen. Das Dach ist undicht, die Toiletten sind dicht, die Betreuer werden immer weniger. »Waren früher Jungen und Mädchen bis 18 Jahre willkommen, dürfen sie jetzt nicht älter als 14 sein. Für Ältere gibt es kein Personal mehr.« Aber gerade die brauchen Aufmerksamkeit. 
Der Protest wuchs. Auf Transparenten stellten die Leute vom Mehringplatz die Frage: »Wann wird Jugendarbeit ausfinanziert?« - »Wo sollen wir einkaufen?« - »Wem gehört der Kiez?« Selbst der ZEIT war der Mehringplatz einen Beitrag wert. Die Politik war im Zugzwang. Im Oktober lud die Bürgermeisterin Anwohner und Initiativen, darunter auch den Revolutionären Anwohnerrat und Abgesandte aus den alternativen Neubauten, zu einem Gespräch ins Jugendzentrum. An drei Tischen wurden Missstände notiert und Lösungsvorschläge erarbeitet. Die Sorgen der Anwohner waren die üblichen: Steckengebliebene Fahrstühle, zunehmende Gewalt, fehlende Ansprechpartner und unsichtbare Hausmeister. Lösungsvorschläge waren: ein Basketballkorb auf einem Parkplatz und eine Schulung für Jugendliche zu Security-Leuten. Mehr Polizeipräsenz. Erste Erfolge waren: die erfolgreiche Ablehnung eines Bauvorhabens durch den Sanierungsbeirat und die Bewilligung von zwei Millionen für Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Rettung des Jugendzentrums. Die eigentlich benötigten 22 Millionen, bemerkte die Bürgermeisterin kleinlaut, gebe es leider erst 2033. Die Hoffnung der Anwohner, dass sich grundsätzlich etwas ändern könnte, ist nicht groß. Präkels & Liske haben in der taz die Stimmung im Kiez sehr gut eingefangen. »Ich hab beim Volksentscheid für die Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen & Co. gestimmt«, sagt einer. »Nur was machen wir mit der Gewobag? Die gehört ja schon der Stadt, und nun schaut euch den Mist hier an!« Doch auch die Gewobag, ergänzen die Autoren, müsse schließlich gewinnorientiert arbeiten. »So will es ihr Hauptaktionär, die Stadt Berlin! Nicht nur Kommunales Wohnen, auch andere eigentlich wohlklingende Begriffe kann hier keiner mehr hören. »Sanierungsgebiet zum Beispiel oder Bürgerbeteiligung. Ständig sollen wir unsere Meinung sagen, aber niemand hört zu. Ich rede mit keinem mehr!« 
Foto: Dieter Peters
|