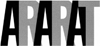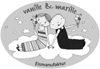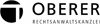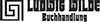April 2025 - Ausgabe 268
Straßen, Häuser, Höfe
|
Der Hohenstaufenplatz 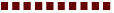
von Werner von Westhafen |
|
|

Foto: Postkarte
Es gibt berühmte Städte im ehemaligen Ostdeutschland, Städte wie Dresden, Leipzig, Weimar. Andere Städte kennen kein Franzose und kein Amerikaner. Cottbus zum Beispiel, auch Chózebuz Kottbuss oder Kottbus geschrieben. Alle vier Schreibweisen sind laut Ständigem Ausschuss für Geographische Namen zulässig. Schon zu DDR-Zeiten haftete an Cottbus der Odem einer von den Kohlebergwerken ergrauten Stadt an der polnischen Grenze. Heute trägt das Städtchen mit seinen 100.000 Einwohnern den Titel der östlichsten Stadt des wiedervereinten Deutschlands. So grau Cottbus auch sein mag: Es muss einmal geglänzt haben, denn keine andere Stadt wurde im Lauf der Jahre so häufig auf Kreuzberger Straßenschildern verewigt wie Cottbus. Es gab die Cottbusser Kommunikation, die einst entlang der Stadtmauer vom Cottbusser Tor zum Köpenicker Tor führte und seit 1968 Skalitzer Straße heißt; Es gab das Kottbusser Ufer, das über 100 Jahre lang vom Kottbusser Tor dem Verlauf des alten Wassergrabens und späteren Landwehrkanals nach Osten folgte, und das 1956 zum Paul Lincke Ufer wurde; es gibt bis heute die Kottbusser Straße und ihre Fortsetzung, den Kottbusser Damm, der 400 Jahre lang zunächst noch Rixdorfer Damm hieß. Dieser Damm wiederum war die Verlängerung der Dresdener Straße, die von der Stadtmitte bis zum südlichen Stadttor führte, von wo aus sie als schnurgerader, um einige Meter erhöhter Damm durch die sumpfigen Wiesen in Richtung Dresden und Cottbus führte. Noch lagen vor den Stadtmauern Gärten, Scheunen und Werkstätten kleiner Handwerksbetriebe. Auf den Wiesen vor dem Kottbusser Tor weideten Frauen ihre Ziegen und ließen sich auch nicht vertreiben, als die Stadt näher rückte und rundum die Häuser immer höher und immer größer wurden. Den störrischen Ziegen und Frauen gelang es, eine kleine Wiese, nur wenige hundert Meter vom Stadttor entfernt, erfolgreich gegen die bereits aus allen Ländern anreisenden Spekulanten zu verteidigen, die Gartenland zu Bauland machen wollten. Ob es die feinen Herren mit den Geldbündeln waren, die die letzte grüne Wiese am Rixdorfer Damm verächtlich Zickenplatz nannten, oder ob es die Ziegenhirtinnen selbst waren, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass es 1889 auch zwischen Boppstraße und Lachmannstraße vorbei war mit dem Gras: Der Platz sollte ein ordentliches Pflaster und einen ordentlichen Namen erhalten. Man einigte sich auf ein altes Adelsgeschlecht aus Schwaben, aus dem einige Jahrhunderte zuvor Herzöge, Könige und sogar Kaiser hervorgegangen waren: Die Staufer. Der tragische Untergang des Königshauses, dessen letzter Spross nach einer verlorenen Schlacht im zarten Alter von 16 Jahren auf dem Marktplatz von Neapel hingerichtet wurde, erregte nicht nur im 12. Jahrhundert die Gemüter, sondern beschäftigte auch im 19. noch Dichter wie Schiller und Uhland. Allerdings gedachten die Stadtväter bei der Namensgebung nicht des jungen Konradin, sondern des bedeutenden Adelsgeschlechtes und machten aus der Zickenwiese den Hohenstaufenplatz, der allerdings dem Kreuzberger Volksmund nicht so recht munden wollte: Bis heute sprechen die Menschen am Kottbusser Damm - unabhängig davon, ob ihre Vorfahren echte Berliner sind, Schwaben, Engländer oder Türken - vom Zickenplatz. Denn auch der Zickenplatz machte Geschichte. Das Kino am Kottbusser Damm, das älteste Berlins und vielleicht sogar ganz Deutschlands, trug zunächst den Namen Lichtspieltheater am Zickenplatz. Wenig später nannte man es Vitascope Theater, noch etwas später Odeon und dann tatsächlich ein paar Jahre lang auch den Namen Hohenstaufen-Lichtspiele. 1959 wurde daraus Das lebende Bild und wiederum ein paar Jahre später das Tali, das in der ganzen Stadt von sich reden machte, weil hier jahrelang an jedem Abend die Rocky Horror Picture Show gezeigt wurde. Es soll viele Kreuzberger gegeben haben, die sich regelmäßig einmal die Woche im damals beliebtesten Kino Berlins trafen, um in passenden Kostümen und ausgerüstet mit Wasserspritzpistolen und Taschen voller Reiskörner bei der berühmten Hochzeitsszene um sich zu spritzen und zu werfen. Wie viele Paare hier für´s halbe oder ganze Leben zusammenfanden oder wie viele Kinder vor flirrendem Filmprojektor gezeugt wurden, ist in keiner Statistik festgehalten, jedenfalls wurde der Film selbst zur schönsten Nebensache der Welt. Das Kino war ständig ausverkauft, die Schlangen sollen bis zum Zickenplatz gereicht haben. Heute nennt sich das Kino Moviemento und präsentiert die ganze Bandbreite der Kinounterhaltung, von Kinderfilmen über Berlinale-Beiträge und Hollywood-Kassenschlager bis hin zu Filmen wirklich nur für Erwachsene. Doch was immer in diesen 118 Jahren seit Alfred Topps erstem Kinosaal über seiner Kneipe am Kottbusser Damm auch geschah: der Volksmund hat die wilde Picture-Show ebenso vergessen wie den armen Hohenstaufer und spricht bis heute noch »vom Kino am Zickenplatz«. Blickte man 1907 den Damm entlang in Richtung Süden, stand zwischen den Wohn- und Geschäftshäusern am Zickenplatz noch der runde Turm mit der kupfernen Pickelhaube und dem Vitascope Theater im Erdgeschoss. Erker, Balkone und kunstvolle Dachgiebel reihten sich die Straße entlang aneinander bis zum Hermannplatz, die Bäume an den Bürgersteigen waren gerade erst gepflanzt worden, das Haus mit dem Kino erst zwei Jahre alt. Und da, wo sich heute bis in die Nacht hinein der Verkehr staut, waren nur hin und wieder ein paar Kutschen eine Straßenbahn zu sehen. |