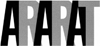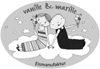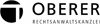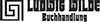April 2025 - Ausgabe 268
Geschichten, Geschichte, Gerüchte
|
Karl Ferdinand Gutzkow 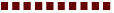
von Michael Unfried |
|
|
|
Zwischen Literatur und Journalismus Nach Karl Gutzkow wurde keine Straße benannt. Doch auch er hat die »Kreuzberger Schule« genossen, drückte mit Adolf Glasbrenner die Schulbank des Friedrich Werderschen Gymnasiums, besuchte als Student die Vorlesungen Hegels, der seine letzten Sommer in einer Villa am Kreuzberg verbrachte; er hörte die Vorträge des Theologen Schleiermacher und die des Philologen August Boeckh, denen zwei Kreuzberger Straßen gewidmet wurden. Wie die meisten dieser Weggefährten war er ein Gegner preußischer Staatsführung, doch übte er seine Kritik nicht mit philisterhafter Ernsthaftigkeit, sondern mit der Ironie seines Schulkameraden Adolf Glasbrenner. Karl Ferdinand Gutzkow war Feuilletonist und Herausgeber, er verfasste 22 Theaterstücke und 400 Seiten starke Romane. Es scheint, als hätte er sich nie entscheiden können, ob er sich Kunst und Literatur oder Journalismus und Politik zuwenden sollte. Seine Kindheit verbrachte der kleine Karl beim königlichen Marstall. Der Vater war der Stallmeister Prinz Wilhelms, doch der Titel war wenig wert: Die siebenköpfige Familie schlief in einem Zimmer mit drei Fenstern, von denen eines zur »Letzten Straße« am Stadtrand hinausging. Ein anderes blickte direkt in den Pferdestall. Dennoch durfte der Sohn studieren. Er war 19, als Hegel ihn mit der Goldenen Medaille der Universität ehrte. Ein Jahr später gab Karl seine erste Zeitschrift heraus, die - bezeichnend für seine Unentschiedenheit - den Titel Forum der Journalliteratur trug. Mit 20 veröffent-lichte er einen Roman mit dem Titel Briefe eines Narren an eine Närrin. Nicht nur, was das Schreiben, auch was den Wohnsitz anging war der junge Mann unentschlossen. Er ging nach Stuttgart zum Literaturblatt, promovierte in Jena zum Doktor der Philosophie, reiste nach Italien und Österreich, wohnte und studierte in Heidelberg, München und Leipzig, wo er für die Allgemeine Zeitung schrieb. 1836 wendet er sich wieder der Literatur zu. Es erscheint ein Roman, der die 2. Folge zum Brief des Narren sein könnte: Wally, die Geliebte eines erfolglosen Dichters, nimmt sich aus Kummer das Leben. So unspektakulär die Geschichte auch klingt, sie macht Gutzkow schlagartig berühmt, denn der Roman wird wegen freizügiger Liebesszenen von der preußischen Zensur konfisziert. »Sie steht ganz nackt,« erdreistet sich der Dichter zu schreiben, »die hehre Gestalt mit jungfräulich schwellenden Hüften, mit allen zarten Beugungen und Linien, welche von der Brust bis zur Zehe hinuntergleiten.« Nicht nur die politischen Weggefährten sehen den wahren Grund der Zensur in seiner kritischen Haltung gegenüber den Christen und deren Antisemitismus. Ein Mannheimer Gericht bestätigt die Vermutung, indem es im Urteil von einer »Verächtlichmachung der Religion« spricht und Gutzkow zu einem Monat Gefängnis verurteilt. Was der Popularität Wallys keinen Abbruch tut, weil der Roman, wie es im Bericht eines königlichen Spitzels heißt, »weiter von Hand zu Hand ging. Selbst 80jährige Greise sind lüstern geworden, ihn zu lesen.« Dass Wally auch die Lüsternheit von Amalia Knölle beflügelte, darf angenommen werden. Denn kaum war Karl Ferdinand aus dem Gefängnis entlassen, heiratete sie den skandalumwitterten Autor und ging mit ihm nach Hamburg, wo er sich abermals dem Journalismus zuwandte, die Leitung des Telegraph für Deutschland übernahm und Friedrich Engels Briefe aus dem Wuppertal veröffentlichte. 1846 schließlich ging er als Dramaturg an´s Dresdener Hoftheater. Wenn er sich auch in der Wahl der publizistischen Mittel nie festlegte, seinen Themen blieb er treu: Der Reichtum der Kirche war ihm ein Dorn im Auge. Zurück in Berlin schrieb er: »Weitentlegen vom Geräusch der Stadt und nur leider in einer zu kahlen, baumlosen Gegend liegt Bethanien, die seit einigen Jahren errichtete Diakonissenanstalt. Dem fast zu luxuriös gespendeten Raume nach könnten noch einmal soviel untergebracht werden. Man hat hier ein Vorhaus, eine Kirche, einen Speisesaal, Wohnungen der Diakonissen und Corridore von einer Ausdehnung, die fast den Glauben erweckt, als wäre die nächste Bestimmung der Anstalt die, eine Art Pensionat oder Stift oder Kloster zu sein, das sich nebenbei mit Krankenpflege beschäftigt.« Generell hat Gutzkow für seine Heimatstadt vor allem Spott übrig: »Berlin wächst an Straßen, mehrt sich an Menschen, aber man kann des Abends um neun Uhr doch am Anhaltischen Bahnhofe ankommen und wird, mit einer Droschke von der Wilhelmstraße zu den Linden fahrend, glauben, in Herculanum und Pompeji zu sein; denn selbst die große Friedrichsstraße gleicht dann schon einer verlängerten Gräberstraße. Auf fünf von der Eisenbahn herwackelnde Droschken zwei Menschen zu Fuß, einer auf dem Trottoir rechts, einer auf dem Trottoir links.« Gutzkow beklagt die Ärmlichkeit der Zimmerausstattung in der »Hauptstadt der Intelligenz« und das »unvermeidliche Wachstuch« in allen Ecken. Das Schlimmste sei der Berliner Witz, nur »ein Anlauf zum Witz, der auf halbem Wege steckenbleibe.« Der Berliner Witz sei »Quatsch«, und jede »zwei mal wiederholte absonderliche Redensart« fände »unverzüglich ihr Publicum.« Schon Engels hatte behauptet, Gutzkows Stärke sei das Feuilleton, worauf Fontane 37 Jahre später hinzufügte: »Er war ein brillanter Journalist, der sich das Dichten angewöhnte.« Gutzkow schrieb seinen letzten Roman 1877: Die neuen Serapionsbrüder. Ein Jahr später brach in seinem Zimmer ein Feuer aus. Sonst schriebe er womöglich heute noch - irgendwo zwischen Literatur oder Journalismus. |