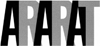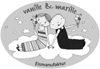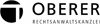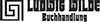Oktober 2024 - Ausgabe 263
Straßen, Häuser, Höfe
|
Die Baruther Straße 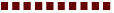
von Werner von Westhafen |
|
|

Barutherstr. 14: Betriebshof für Kraftwagen der Berliner Omnibus AG - Foto: Bundesarchiv
Als die Straße an der roten Backsteinmauer der Friedhöfe am Halleschen Tor noch ganz neu war, standen noch alle 22 Häuser: Von der Nummer 1, dem stattlichen Eckhaus am heutigen Mehringdamm und der damaligen Belle Alliance gegenüber des heutigen Finanzamtes und damaligen Sitzes der Dragoner mit ihren Soldatenquartieren und Pferdeställen bis hinüber zum Eckhaus mit der Nummer 22 an der Zossener Straße. Die Baruther ist eine kleine Straße, nur zwei Querstraßen zweigen Richtung Süden von ihr ab: die Nostitzstraße und die Solmsstraße. Man hatte lange über den Namen des Sträßchens diskutieren müssen, das zunächst unter der pragmatischen Bezeichnung Straße Nr. 31 in die Karten eingetragen wurde. Der Bauunternehmer Lindenberg, der den sandigen Weg 1862 gepflastert hatte, wollte die Gelegenheit nutzen und seinen Namen auf einem Straßenschild verewigen. Er schlug neben einer »Frühlingsstraße« und einer »Liegnitzer Straße« auch eine »Lindenbergstraße« vor. Der Name des Maurers war den Beamten des Magistrats zu unbedeutend, dem Polizeipräsidium wie-derum war der Frühling zu poetisch, und Liegnitz war allen zu weit. Zehn Jahre später erhielt immerhin eine Straße am Landwehrkanal diesen Namen. An der Friedhofsmauer einigte man sich 1864 auf eine hübsche Ortschaft mit Schlösschen und Park am Rande des hügeligen Flämings, etwa eine halbe Reitstunde südlich von Zossen: Baruth. So wie damals der Reiter auf dem Weg nach Baruth über Zossen kam, so kamen die Fußgänger von der Allee der Gneisenaustraße jetzt über die Zossener Straße in die Baruther Straße. Der Name überstand Regierungen und Zeitenwenden, doch in die Häuserzeile gegenüber des Friedhofes rissen die Bomben tiefe Löcher. Die Nummer 1 und 2 hielten stand, die Nummer 3 wurde schwer getroffen. Auf der freigeräumten Fläche zwischen den Brandmauern siedelte sich eine Autowerkstatt an. Bis vor drei Jahren schraubte Solmaz in zwei alten Schuppen die Autos der Nachbarschaft zusammen: »Der war gut,« meint der Besitzer des Comicladens aus der 10. »Dem hab ich meinen Autoschlüssel gegeben, und wenn er mal eine Lücke hatte im Terminkalender, holte er sich das Auto und machte es fertig. Nie Probleme gehabt.« Als die Eigentümerin des Grundstückes starb, musste der Mechaniker seine Werkstatt abbauen. Drei Millionen, raunt die Nachbarschaft, wollte die Erbengemeinschaft für eines der letzten freien Grundstücke in der Gegend. Aus den ausgebombten Häusern mit den Nummern 4 bis 6 sind Eigentumswohnungen in bester Lage und mit Blick ins Grüne geworden, auch eine Kirche hat sich hier niedergelassen. Von der Nummer 7 bis zur 10, dem Eckhaus an der Nostitzstraße, tragen die Häuser noch den Gründerzeitcharme vergangener Zeiten. Dann riss der Krieg eine große Lücke in die Häuserreihe. Auf den Grundstücken 11 bis 17 steht kein einziges Haus mehr, selbst das Straßenpflaster des Herrn Lindenberg ist verschwunden, nur noch ein schmaler Fußweg führt heute entlang der Mauer von der Nostitzstraße zur Solmsstraße. Das verwaiste Straßenstück vor den abgeräumten Ruinen zwischen Nostitz und Solmsstraße überwucherte allmählich. Nur die Laternen und die gerade Linie der Bäume, die einst am Straßenrand gestanden hatten und von den Baggern verschont wurden, erinnern heute noch an den ehemaligen Straßenverlauf der Baruther Straße. Als Anfang der Achtzigerjahre ein Kindergarten und die Lenauschule auf der großen Brache zwischen Friedhof und Gneisenaustraße eingeweiht wurden, konnten auf ihr wieder die Kinder spielen und sogar Schafe weiden. Das war der Verdienst des langjährigen Schulrektors und berühmten Fußballfunktionärs Otto Höhne, der sich allen Verboten und Gesetzen zum Trotz erlaubte, die Grenzen des Schulgeländes um einige Meter nach Norden zu verschieben und eine Seite der Baruther Straße in Weiderland für seine Schafe zu verwandeln. »Was, die Kreuzberger Kinder kennen keine Tiere?«, soll er ausgerufen haben. »Wir holen uns welche und bringen sie auf dem Schulhof unter!« In den Jahren vor dem Krieg war an Schafe und Kinder nicht zu denken. Gerade hier, auf dem Grundstück Baruther Straße 14, herrschte reger Großstadtverkehr. Bereits 1907 hatte die Allgemeine Berliner Omnibusgesellschaft ABOAG das 7000 Quadratmeter große Areal zu einem Omnibusdepot für benzinbetriebene Fahrzeuge umgebaut. Im Zehnminutentakt fuhren die Busse an der Baruther Straße ein und an der Gneisenaustraße wieder aus. Auch heute sind Schafe auf der Straße undenkbar. Wo vor drei Jahren noch stattliche Bäume den Schulhof der Lenauschule beschatteten, dehnen sich jetzt trostlose Betonflächen aus. Erst hinter dem Schulneubau sieht die Welt wieder freundlicher aus. Auf Höhe der Solmsstraße wird die Baruther wieder zur breiten Straße, an der sich von der Nummer 18 bis zur 21 eine Gründerzeitfassade an die andere reiht - darunter die der ehemaligen 226. Knaben-Gemeindeschule. Ganz am Schluss aber, an der Ecke zur Zossener Straße, steht der rosafarbene Neubau der Nummer 22. In der Ruine, die sich noch Jahre nach dem Krieg dort befand, hatte bis zu ihrem Abriss Kreuzbergs Vorzeigekünstler Kurt Mühlenhaupt sein berühmtes Künstlerlokal. Das Schicksal muss gekichert haben, wenn es den langjährigen Kreuzberger, der, als seine Mutter im Zug die Wehen überfielen, in der Nähe des Bahnhofs von Baruth das Licht der Welt erblickt hatte, nun wieder zurück in die Baruther Straße führte. |