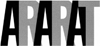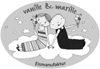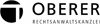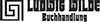Oktober 2024 - Ausgabe 263
Reportagen, Gespräche, Interviews
|
Gieß den Kiez 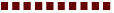
von Achim Fried |
|
|
Was eine Stadt von ihren Bürgern erwartet
Es ist einer dieser heißen Tage im September, über dem Teerstreifen zwischen den Häuserreihen der Friedrichstraße, die vom historischen Halleschen Stadttor bis in die Stadtmitte führt, flimmert die Luft. Die kleinen, fast baumlosen Quadrate des Besselparks und des Theodor-Wolff-Parks versuchen vergeblich, Schatten zu spenden und CO2 zu speichern. Doch auf dem Grundstück der Friedrichstraße 18 klafft noch eine Lücke. Auf der Kriegsbrache stehen vier Bäumchen, darunter im Schatten einige Sitzgelegenheiten und Tische und, etwas zurückgesetzt, ein zum »Kiezlabor« umgebauter Container mit Küche, Bildschirm und einer Sitzecke. Im hinteren Teil der Baulücke wachsen in hölzernen Blumenbeeten Tomaten und Bohnen, Bienen summen in zwei Stöcken. »Ein Volk ist mir gestorben!«, sagt der Afrikaner, der aus seiner sonnenverbrannten Heimat gekommen ist und nun im sonnenverbrannten Berlin gärtnert. Er kennt sich aus mit hohen Temperaturen. Den kegelförmigen Lehmofen, der aussieht wie ein gigantischer Termitenhügel, hat er gebaut, um an lauen Abenden für sich und seine gärtnernden Freunde Pizza oder Brot zu backen. Seine Bienen hielten den Lehmhügel offensichtlich für eine ideale Wohnstätte und »haben ihn in einer einzigen Nacht« mit hunderten von Schlupflöchern durchstochen wie einen Schweizer Käse. Er lacht. Die Natur ist stärker als wir - und sie macht, was sie will. Den meisten, die sich heute vor dem Kiezlabor treffen, geht es um den Erhalt der Stadtnatur und die Rettung des Klimas. Im hand-geschriebenen Programm auf der Stelltafel stehen »Bürgerdienstleistungen ohne Termin«, ein Vortrag über »gestresste Straßenbäume«, ein Textilworkshop, natürlich »Kaffee und Kuchen« und eine abendliche Filmvorführung über »Gärtnern in der Stadt.« »Gieß den Kiez« ist die bekannteste Aktion des Kiezlabors, das während der Sommermonate mit unterschiedlichen Themen durch die Bezirke der Stadt tourt und die Bürger zum Beispiel über den Wasserbedarf der verschiedenen Stadtbäume unterrichtet. Auf Informationstafeln und in Broschüren wird Naturkundeunterricht erteilt, Diskussionen, Vorträge und Kompostseminare finden statt. Doch es geht nicht nur um die Flora. Flyer werben für den »Antifaschistischen Fahrradkorso zu Orten der Erinnerung an NS-Terror und Widerstand« oder fordern »Solidarität für Pazifistinnen aus Osteuropa«. Trotta singt Lieder von Erich Mühsam, Sätze wie »Kriegsdienstverweigerung ist kein Verbrechen!« und »Den Frieden gewinnen und nicht den Krieg!« werden fett geschrieben. Die Kriegsbrache in der Friedrich-straße erinnert ein bisschen an die von Flugblättern übersäten Stände politischer Studentenfeste auf Universitätshöfen der Siebzigerjahre. 
Der schicke Container aber passt nicht ins Bild der Sechzigerjahre. Die Einrichtung des Kiezlabors oder Citylabs und der Transport des 16 Tonnen schweren Büros durch die halbe Stadt wäre für eine echte Volksinitiative nicht zu bewältigen. Auch die 36 Seiten starke, auf edlem Papier gedruckte Broschüre hat nichts mehr zu tun mit den hausgemachten Flugblättern vergangener Zeiten. »Raum für Beteiligung« steht auf dem farbigen Umschlag, finanziert von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Dass der Senat die Aktionen des Kiezlabors fördert und nichts dagegen hat, wenn die Zivilbevölkerung zum »Mitmachen an Freiwilligentagen« aufgefordert wird, um die Arbeit der städtischen Gärtner zu unterstützen und die Staatskasse zu entlasten, ist verständlich. Es geht aber in der Broschüre nicht nur um eine Bürgerbeteiligung beim Gießen der Stadtbäume. Es geht, wie der Senat es formuliert, um »die Zukunft der Stadt« und um ein neues Konzept, das mehr Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung ermöglichen soll. Das Kiezlabor ist dabei behilflich, die Idee des neuen Konzeptes in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Geschichte der Citylabs beginnt eigentlich schon 2016, als Grüne, SPD und Linke beschlossen, Leitlinien für Bürgerbeteiligungen bei politischen Entscheidungen zu erarbeiten. Mit der Konkretisierung dieses Plans wurde die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung beauftragt. Angestrebt wurde ein »verstärkter Dialog mit der Stadtgesellschaft« sowie deren »Möglichkeit einer direkten Einflussnahme«. Von Mitteln »direkter Demokratie« war die Rede, von »mehr Transparenz« und »neuen Formen der Kommunikation«. Das hörte sich an, als wären die Stimmen jener unermüdlichen Systemkritiker endlich erhört worden, die schon immer mehr Mitspracherecht forderten und der Berliner Politik seit fünfzig Jahren das Leben schwer machen. Immer wieder gelang es ihnen, mit kleinen Flugblättern mehr Menschen zu ihren Versammlungen zu locken als die Politik mit ihren riesigen Wahlplakaten. Selten war die Passionskirche am Marheinekeplatz so voll wie anlässlich der Diskussionsveranstaltungen über die geplante Bebauung der Bergmannfriedhöfe oder 2006 die Renovierung der Markthalle; Jahrelang mussten sich Politiker mit Anwohnern der Bergmannstraße über die Einrichtung einer Begegnungszone streiten, und noch heute muss sich Kreuzbergs Baustadtrat mit dem Widerstand gegen das entstehende Luxusviertel auf dem Boden der alten Bockbrauerei an der Fidicinstraße auseinandersetzen. Am härtesten ist der Kampf ums Tempelhofer Feld, Berlins größte Spielwiese, die SPD und CDU unbedingt bebauen möchten. Auf dem Feld geht es längst nicht mehr um die Frage, ob eine Bebauung sinnvoll ist, sondern nur noch darum, wer hier das Sagen hat. Die Broschüre mit den 36 Seiten des Leitfadens für Bürgerbeteiligungen stellt endgültig klar, wer in der Stadt das Sagen hat. Das Schriftstück macht deutlich, dass es weniger darum geht, den Bürgern entgegenzukommen und ihnen ein verbrieftes Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht einzuräumen, sondern vielmehr darum, den unkontrollierbaren Bürgerversammlungen Regelungen entgegenzusetzen. Um etwaige Bedenken seitens der Wirtschaft oder politischer Gegner gegenüber einer Ausweitung von Bürgerbeteiligungen von vornherein auszuräumen, stellt die Broschüre klar, dass Investoren durch eine frühzeitige Einbeziehung der Bürger Zeit und Geld sparen würden: Mit einer geregelten und rechtzeitigen Bürgerbeteiligung gleich zu Beginn der Planungsphasen »lassen sich spätere Verzögerungen vermeiden.« Ein Ziel der neuen »Leitlinien für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Projekten und Prozessen der räumlichen Stadtentwicklung« sei, wie es auf der ersten Seite heißt, »ein tieferes Verständnis für demokratische Prozesse.« Da dieses Verständnis bei den Berufspolitikern vorausgesetzt werden muss, kann es also nur noch von den Bürgern eingefordert werden. Mit anderen Worten: Man fordert von der Bürgerschaft mehr Verständnis für realpolitische Entscheidungen und mehr Disziplin im Umgang mit den Politikern. Damit auch der einfache Bürger versteht, was gemeint ist, formuliert es die Broschüre im Kindergartendeutsch: »Gut miteinander umgehen«. Da der Senat berechtigte Zweifel an der Wirksamkeit seines Aufrufs zu mehr Sitte und Anstand in Auseinandersetzungen zwischen Volk und Staat hat, behält er sich bei Bürgerbeteiligungen ein Veto vor: Zwar haben jeder Berliner und jede Berlinerin im Prinzip das Recht, etwa gegen ein Bauvorhaben zu protestieren, doch muss für einen Protest zuerst ein Antrag gestellt werden. Über diesen berät und entscheidet dann ein 24-köpfiger Beirat, zusammengesetzt zur Hälfte aus Berufspolitikern, zur anderen Hälfte aus von einem Zufallsgenerator ausgewählten Volksvertretern. Eine offene und demokratische Wahl der 12 Volksvertreter wäre glücklicher gewesen. Dieser von der Politik gewählte Beirat hat die exklusive Möglichkeit, Diskussionen über etwaige Anliegen von Bürgern oder Initiativen von vornherein abzulehnen. Aber auch dann, wenn Bürgerinnen und Bürger die erste Hürde genommen haben und der Beirat ihre Bedenken für berechtigt hält, sind die Möglichkeiten einer Mitgestaltung bescheiden, denn es gibt nur einen begrenzten »Entscheidungsspielraum«. Im Leitlinienpapier heißt es: »Der Entscheidungsspielraum soll vor Beginn eines Beteiligungsprozesses offengelegt und erörtert werden.« Nur »innerhalb dieses Spielraumes ist das Ergebnis des Beteiligungsprozesses offen.« Es muss also vor einer genehmigten Bürgerbeteiligung zuerst festgelegt werden, »zu welchen Punkten, zu welcher Zeit und auf welcher Ebene Einflussmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger bestehen.« Dadurch kann - wie es im Fall Bergmannstraße bereits geschehen ist und wie es auf dem Tempelhofer Feld gerade wieder geschieht – nicht mehr darüber diskutiert werden, ob umgebaut oder bebaut wird, sondern nur noch darüber, wie gebaut wird. Prominentester Nutzer dieses praktischen Politik-Instrumentes ist Christian Gaebler, der amtierende Bausenator der CDU, der zum Tempelhofer Feld äußerte, es ginge jetzt nicht mehr »um das Ob, sondern nur noch um das Wie«. Im so genannten Bürgerbeteiligungs-verfahren wurde die Option einer Nichtbebauung des Feldes aus dem »Entscheidungsspielraum« von vornherein ausgeschlossen. Das ist moderne Demokratie! Sollten die einst von Linken & Grünen verfassten und nun von der CDU »überarbeiteten« Richtlinien zur Bürgerbeteiligung in Gesetze münden, wäre das eine traurige Nachricht. Das Regelwerk würde die Möglichkeiten der Mitbestimmung nicht erweitern, sondern einschränken. Im Kiezlabor aber glaubt man noch immer daran, mit den digitalen Diskussionsplattformen mehr Menschen erreichen zu können als bisher. Zwar gebe es schon jetzt die Verpflichtung, die Öffentlichkeit zu informieren, doch wenn auf der Website des Bezirksamtes und in »Zeitungen per Anzeige« informiert wird, wo Baupläne ausliegen, erreiche man keine große Öffentlichkeit. Das könne sich jetzt ändern. Auch Regeln zur Mitbestimmung könnten ein geeignetes Instrument sein, um der Willkür des Senats einen Riegel vorzuschieben. Doch diese Regeln sind nicht auf dem Kompost des Kiezlabors oder der Stadtbewohner gewachsen, sie kommen vom Misthaufen des Senats. Das Kiezlabor mit seinen jungen Studentinnen ist lediglich ein ausführendes Organ und nur eines von vielen Projekten der vom Senat unterstützten Technologie Stiftung Berlin, die seit Jahren an digitalen Diskussionsplattformen für Volk und Staat arbeitet. Ein Unternehmen, das das Zeitalter öffentlicher Versammlungen bald in die Geschichtsbücher verlegen könnte. Moderne Bürgebeteiligung könnte künftig nur noch im undurchsichtigen Darkroom des Internets stattfinden. Eine Student sitzt am Tisch unter den Bäumen in der Friedrichstraße und reicht einem Rentner ein Glas Wasser. Zwei Generationen kommen ins Gespräch. Der Student sagt, man wolle Impulse setzen. »Wir sehen uns als eine digitale Brücke zwischen Politik und Bürger.« Der Rentner äußert Zweifel an den Möglichkeiten des Internets: »Wie schnell hab ich in so einer Onlinepetition mein Kreuzchen gemacht, um ein Stück Regenwald zu retten. Das ist nur ein Klick. Aber dann mit der Gießkanne runterzugehen und den Baum gießen....« Damit hat »Gieß den Kiez« einst begonnen: mit einer Handvoll Menschen, die Bäume vor ihren Häusern gossen. Inzwischen ist daraus eine digitale Plattform gewachsen mit einem Lageplan von 885.825 Bäumen und 10.000 Freiwilligen, die in den letzten drei Jahren über 2 Millionen Liter Wasser vergossen haben. Das ist ein Erfolg für die Technik und den Senat. Mit gesetzlich vorgeschriebenen Einschränkungen bei Bürgerbeteiligungen aber wird der Senat scheitern. Das Misstrauen gegen undurchsichtige, digitale Auswahlverfahren wächst, und Maßnahmen zur Verstümmelung demokratischer Mitspracherechte waren noch nie sonderlich populär. |