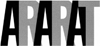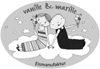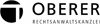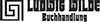November 2024 - Ausgabe 264
Straßen, Häuser, Höfe
|
Bergmannstraße 109 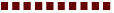
von Charlotte Wissmann |
|
|

Er spricht von einem »repräsentativen Mehrfamilienhaus in absoluter Bestlage« und einem »Leben dort, wo Multikulti zuhause ist.« Er wirbt mit »Cafes, Kneipen und Restaurants jeglicher Geschmacksrichtung« sowie »Menschen jeder Kultur und Nationalität«, mit Frühstück im Cafe morgens um 9 Uhr und einem »Dönner abends um 23.00 Uhr«, »Topanbindung« ans Verkehrsnetz usw usf… - Also Wohnen wie im Film! Die Residenz sei »lichtdurchflutet« und komplett mit Parkett belegt, das »absolute Highlight« aber sei das ausgebaute Dachgeschoss und »die zum Hof ausgerichtete sonnendurchflutete Dachterrasse, uneinsehbar von der Straße, sehr ruhig und geschützt.« Ach, die Bergmannstraße ist nicht mehr, was sie einmal war! Vor der kleinen Tischlerei zwei Häuser weiter sitzt Tischler Köppen noch auf den zwei Treppenstufen seiner Werkstatt und genießt die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Er kann sich noch gut an das Nachbarhaus erinnern mit dem kleinen Kino im Hinterhof. Jetzt ist eine Galerie in den Kinosaal eingezogen, doch weit herumgesprochen hat es sich noch nicht in der Straße. Kein Schild weist den Weg vom Gehsteig in den Hof. Im Internet allerdings schafft es die Galerie HOTO, nach eigenen Worten »the home of artists«, immerhin schon auf die erste Seite. Die Galeristen sind junge Leute, am Abend ist eine Vernissage, an den Wänden hängen großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien, eine Band aus der Schweiz ist angereist und macht den ersten Soundcheck. Alles sieht vielversprechend aus, doch die Website der Galerie liest sich wie die des Immobilienhändlers: »Zentral in Berlin Kreuzberg liegt die HOTO Galerie«, die über eine »offene Bar, eine Hifi-Anlage und zwei separate Räume« verfügt. »Die Location ist vielfältig einsetzbar und eignet sich nicht nur für Events, sondern auch als Motiv für Foto- und Filmarbeiten. Die Räume werden mit einer Grundausstattung vermietet und können optional mit hochwertigem Mobiliar ausgestattet werden.« Die Bergmannstraße ist nicht, was sie war, damals, als der erste Kinematograph im kleinen, akkurat aus Backsteinen gemauerten Saalbau im Hinterhof aufgestellt wurde. Der spätere Kinobesitzer Georg Rosenberg berichtete, dass bereits 1906 die ersten bewegten Bilder über die Hinterhofleinwand in der Bergmannstraße flimmerten, in der ewigen Kinoliste aber wird das »Saalkino« in der Bergmannstraße erst 1909 von Ernst Krämer eröffnet: »In der Bergmannstraße 109 befanden sich die Lichtspiele Bergmannshöhe«. Um 1900 standen die Leute vor Emil Potts Dunkelkammer in der Kottbusser Straße noch in der Schlange, um das »lebende Bild« sehen zu können. Inzwischen standen Kinemathographen überall in Berlin. Beinahe 400 Kinosäle zählte die Stadt, darunter Filmpaläste mit 1000 Sitzplätzen und Foyers. Allein im heutigen Kreuzberg verzeichnet die Statistik im Jahrhundert zwischen 1896 und 1996 über 80 Lichtspieltheater. Die Konkurrenz war groß, die ständig neueste Technik teuer, weshalb viele Kinobetreiber nicht lange durchhielten. In der Bergmannstraße suchten nach Krämer noch 10 andere Kleinunternehmer ihr Glück. Sie modernisierten, bauten aus und an, wechselten das Programm und fügten den 200 vorhandenen Sitzplätzen noch einmal 60 hinzu, doch alles half nichts: Mit der Inflation Anfang der 20er Jahre erlosch auch der flimmernde Lichtstrahl der Projektoren. Als das Schlimmste überstanden war, eröffneten 1928 die Skala-Lichtspiele, und 1932 übernahmen gleich drei Frauen nacheinander für jeweils zwei oder drei Jahre die Regie im Kino. Sie machten aus den Skala-Lichtspielen das Marabu-Lichtspieltheater, eröffneten mit einem Kassenschlager namens »Gigolo« und spielten fortan sieben Tage in der Woche am Nachmittag und am Abend. Den Krieg überstand das Kino unbeschadet, doch in den Nachkriegsjahren tat es sich schwer. 1953 wurde es stillgelegt, um ein Jahr später als Allotria wieder aufzuerstehen. Ein pfiffiger Architekt schuf ein modernes Filmtheater mit Cinemascope-Leinwand und immerhin schon 290 Sitzplätzen, deren verschiedenfarbige Holzreihen die unbequeme Stahlkonstruktion ablöste, die eine ehemalige Waffenschmiede der Nazis anstelle der Plüschsitze installiert hatte. Auch das martialische Eisengitter an der Theaterkasse verschwand ebenso wie das Foyer, das in der Ladenzeile eingerichtet worden war. Nun betrat man das Kino durch den Hinterhof. Noch einmal 20 Jahre lang surrte in der Bergmannstraße der Projektor. Der letzte und bereits zwölfte Inhaber war die Ravenna-Film GmbH aus Mannheim. Sie hielt nur ein Jahr durch, obwohl sie eine gute und politisch sehr korrekte Idee hatte, indem sie ein Programm für die vielen in Kreuzberg ansässigen Gastarbeiter gestaltete mit Filmen aus Italien und der Türkei, manchmal sogar in türkischer oder italienischer Sprache. Doch die Gastarbeiter waren müde und kamen nur an den Wochenenden. Ein Jahr nach der Eröffnung gaben auch die Mann-heimer auf. Sie hatten gegen den Siegeszug des Fernsehers in deutschen Wohnzimmern keine Chance mehr, und seit 1972 gibt es kein Kino mehr in der Bergmannstraße. |