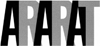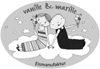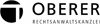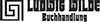November 2024 - Ausgabe 264
 |
Kreuzberger
Kadir Albay Wir sind doch Menschen! 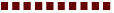
von Hans Korfmann
|
|
|

Kadir Albay ist schon sehr lange in der Zossener Straße. Er ist alt geworden hier und hat viel erlebt in den vielen Jahren. Auch Trauriges. Es ist noch gar nicht lange her, da starb seine Frau. Sie erkannte ihn nicht mehr, wenn er sie besuchte. Vielleicht war Kadir Albay schon immer ein zurückhaltender und stiller Mensch, aber jetzt ist er noch ein bisschen stiller geworden, und wenn ein Unbekannter an der Ladentür klopft, streckt er ihm nur zögernd seine Hand entgegen. Aber wenn sie dann einige Worte wechseln und Kadir Albay ahnt, dass der Unbekannte vor seiner Tür tatsächlich etwas versteht von Klavieren und Flügeln, dann betrachtet er den Fremden schon etwas aufmerksamer. Und wenn der Fremde dann von den Hammerköpfen und der Mechanik spricht oder den Namen einer seltenen Klaviermarke erwähnt, dann huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis Kadir Albay zu erzählen beginnt: die Geschichten von den alten Instrumenten oder den Menschen, die auf ihnen spielen oder mit ihnen arbeiten. Alles begann 1957, als Kadir Albay, der Tischlerlehrling, von Ankara nach Istanbul ging, um bei einem Antiquitätenhändler im Bazar von Beyazit zu arbeiten. Von morgens bis abends hielt Kadir einen alten Lappen in der Hand, um altersgraue Möbelstücke auf Hochglanz zu polieren. »Alles mit Schellack! Das dauert ewig!« Es gab nicht nur Tische, Stühle und Schränke dort, sondern auch Flügel und Klaviere. Die riesigen Instrumente schienen aus einer anderen Welt zu kommen und passten nicht in dieses enge Altstadtviertel, in diesen verschnörkelten Orient mit seinen Wasserpfeifen und den kleinen, dickbäuchigen Saiteninstrumenten aus den Tanzlokalen. Diese Instrumente kamen aus großen, hellbeleuchteten Sälen, aus fernen Städten mit klangvollen Namen wie Paris, London oder Rom. Nichts glänzte so wie ein schwarzer, mit Läusesekret polierter Konzertflügel. Ab und zu kam ein alter Mann vorbei, »der war vielleicht schon 75 oder so. Der kam, um die Flügel zu stimmen.« Eines Tages fasste sich Kadir ein Herz, trat auf ihn zu und sagte: »Ich möchte gerne bei Ihnen lernen.« Wochenlang schleppte Kadir nun die schwere schwarze Werkzeugtasche durch die Gegend. Aber er gab nicht auf. Er sah dem alten Mann auf die Finger, stellte Fragen, notierte alles in fein säuberlicher Schrift in ein dickes Notizbuch. Das hat er heute noch. Eines Tages sagte der Alte zu ihm: »Wenn Du wirklich etwas über Klaviere und Flügel lernen willst, dann musst du nach Deutschland gehen!« Da gerade jene Jahre angebrochen waren, in denen das vom Krieg zerstörte Deutschland händeringend in halb Europa nach Arbeitskräften suchte, unterschrieb Kadir Albay einen Arbeitsvertrag mit einer deutschen Möbelbaufirma, setzte sich 1965 mit drei anderen jungen Männern in den Istanbul-Express und stieg nach drei Tagen Zugfahrt in Paderborn wieder aus. »Ich sprach kein einziges Wort Deutsch, nur Ja und Nein, und ich kannte niemanden in der Stadt, ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, dass ich Klavierbauer werden wollte!« Auch in Paderborn landete er wieder auf der untersten Sprosse der Karriereleiter und war nur einer unter vielen Italienern, Spaniern, Türken und Griechen, die in Deutschland Geld verdienen wollten. Albay wollte kein Geld verdienen. Albay, der Spezialist für Schelllackpolituren, bewarb sich bei Klavierfabrikanten in ganz Deutschland, unter anderem bei der Firma Ibach in Wuppertal. Die bauten große Konzertflügel. Wieder stieg Albay in den Zug und fuhr nach Stuttgart, »das war an einem Donnerstag. Die wollten mich auch einstellen. Aber am Samstag fand ich in meinem Briefkasten einen Brief von Manthey aus Berlin. Da hatte ich mich auch beworben. Und Berlin war doch Hauptstadt der Klavierbauer! Es gab einmal 300 Klavierbauer in Berlin!« Kadir Albay zögerte nicht lange und stieg abermals in den Zug. Kadir hatte ein Ziel. Die Firma Manthey lag in der Reichenberger Straße 125 in Berlin Kreuzberg, im türkischen Viertel. Kadir Albay sägte, schraubte, feilte, leimte, bohrte, kümmerte sich um die hölzernen Klangkörper und die filigranen Notenständer. Er ersetzte die Hammerköpfe, brachte sie unter der Flamme eines kleinen, verbeulten kupfernen Spiritusbrenners wieder in Form, wenn sie sich im Lauf der Jahre verzogen hatten. Er dämpfte die hölzernen Köpfe mit dünnem, grünem Filz, zog goldglänzende Kupfersaiten auf und kümmerte sich um die gusseiserne Mechanik. 1967 schloss er wahrscheinlich als erster Türke überhaupt in Deutschland eine Lehre als Klavierbauer ab. Aus dem Tischlerlehrling war ein Klavierbauer geworden. Gleich neben der Firma Manthey, nur durch eine dünne Mauer getrennt, in der Reichenberger Straße 124, waren die Fabrikations-hallen der Firma Bechstein. Bechstein baute riesige, 2,80 Meter lange, Konzertflügel. Das Ziel seiner Träume war in greifbare Nähe gerückt. Es dauerte nur ein Jahr, da nahm Albay die letzte Hürde und begann auf der anderen Seite der Mauer Flügel zu bauen. Als Kadir Albay 1968 beim Bechstein begann, war er ein Exot: der erste Türke in der weltberühmten Firma C. Bechstein, die einmal 800 Angestellte gehabt hatte und noch in den Sechzigerjahren jedes Jahr 1000 Flügel auslieferte. Doch die ganz großen Jahre der Berliner Klavierbauer waren vorbei. Irgendwann waren sie noch vier: Bechstein, Manthey, May und Biese. Jede von ihnen bildete im Jahr zehn Lehrlinge aus. Zum Schluss blieb nur noch Bechstein. Als auch Bechstein seine Produktion nach Tschechien verlegte und Albay 1980 seine eigene Werkstatt eröffnete, war diese der letzte Ausbildungsbetrieb für Klavierbauer in Berlin. Albay steht vor den Urkunden und Fotografien an der Wand. Er zieht die Augenbrauen hoch: »Henri Seiferth! Der hat hier in meiner Werkstatt gelernt und ist nach der Lehre nach Stuttgart gegangen. Es gibt ja nur noch eine einzige Schule in Deutschland, auf der man Meis-ter werden kann im Klavierbauer-Handwerk. Und die nimmt alle zwei Jahre nicht mehr als 30 Schüler auf. Viele fallen durch. Henri Seiferth hat es geschafft.« 
Kadir Albay liebt seine Arbeit. Von sich selbst erzählt der alte Mann nicht viel. Nicht von der schönen Französin, die er, kaum in Berlin angekommen, heiratete, und nicht von der schönen Türkin, die ihren Mann am Ende nicht mehr wiedererkannte. Kadir Albay erzählt lieber von den Flügeln. Von dem Mahagoni zum Beispiel, den er in Neu-Westend gekauft hatte, für 2000 Mark. Als die Transportfirma mit dem Instrument eintraf, berichteten die Möbelpacker von einer alten Frau, die in Tränen ausgebrochen sei, als sie den Flügel aus dem Haus trugen. Der Klavierbauer hatte schon zwei Tage an der Mechanik gearbeitet und gestimmt, da klingelte das Telefon. Der Sohn der alten Frau erklärte, dass seine Mutter seit drei Tagen unaufhörlich weine. Dann fragte er, ob es möglich wäre, den Flügel wieder zurück zu bringen. Kadir Albay war gerührt. Albay liebt Flügel. Und er liebt Menschen, die Flügel lieben. »Das Instrument hatte diese Frau durchs ganze Leben begleitet. Es war schon da gewesen, als sie noch ein kleines Kind war. Immer, immer…« Der Klavierbauer ließ den Flügel wieder zurückbringen und wollte auch kein Geld für seine Arbeit. Nur den Transport sollte die Familie bezahlen. Der Sohn protestierte. Aber es ist schwer, sich gegen einen Mann durchzusetzen, der sich 1957 in der Türkei in den Kopf setzt, Klavierbauer zu werden, und der dann der erste türkische Klavierbauer Deutschlands wird. »Wir sind doch Menschen. Es gibt doch wichtigeres als Geld!« Ein paar Tage später kam ein riesiger Geschenkkorb in seiner Werkstatt an, »voll mit Champagner, Wein, Kaviar und Schokoladen! Das ist doch wunderbar!« Das Wunderbarste in seinem Leben aber war wohl die schwarze Limousine, die eines Morgens vor dem Gästehaus in Ankara stand. »Jeden Morgen kam sie vorgefahren, glänzend wie ein gut polierter Konzertflügel. Der Chauffeur stieg aus, ging um das Auto herum, öffnete mir die Tür und sagte mit eine kleinen Verbeugung: Guten Morgen, Herr Albay. Was für eine Ehre! Ich hätte nie geglaubt, dass ich so etwas einmal erlebe.« Jeden Abend lud man den deutschen Klavierbauer zu einem großen Essen ein, von seinem Zimmer aus blickte er auf das Denkmal des großen Mustafa Kemal Atatürk. Der hatte 1932 in Berlin einen Bechstein-Flügel gekauft. 72 Jahre später, anlässlich eines Staatsbesuches des russischen Präsidenten, sollte dieser Flügel, der seit 30 Jahren keinen Ton mehr von sich gegeben hatte und inzwischen »rot lackiert!« worden war – Kadir Albay rauft sich die Haare, wenn er das Bild dieses verunstalteten Flügels zwischen seinen Urkunden sieht - wieder zum Leben erweckt werden. Da sich im eigenen Land niemand fand, dem man solch ein Kunststück zutraute, rief man bei Bechstein an. Dort nannte man ohne zu zögern einen Namen: Kadir Albay. Zwei Wochen des Jahres 2004 saß Kadir Albay am Flügel des großen Atatürk, aß und trank jeden Abend wie ein Fürst. Und dann kam der Tag, an dem der Flügel feierlich präsentiert wurde. »Es war einfach wunderbar, dieser riesige Saal mit Lüstern und Teppichen und einer Bühne – und dann öffnete sich ganz von allein der Vorhang und da stand nichts, nur dieser schwarze, glänzende Flügel von Bechstein aus der Reichenberger Straße. Und alle applaudierten.« Als der alte Bechstein einige Jahre später in schlechter Stimmung war, rief man aus dem Palast gleich bei Kadir in der Zossener Straße an. Er solle kommen und den Flügel stimmen. Inzwischen kannte man den Klavierbauer aus der Zossener nicht nur in der Türkei. Journalisten und Fernsehteams aus der ganzen Welt reisten an, »aus Russland, Japan, England. Der RBB war da und das ZDF. »Ach, ich weiß gar nicht mehr. Und was die alles geschrieben haben. Das habe ich nie gesagt!« Es ist wunderbar, wenn so ein Flügel aus Albays Kellerwerkstatt in der Zossener Straße herauskommt und plötzlich im Scheinwerferlicht steht. Trotzdem ist Kadir Albay die hell erleuchtete Welt der Bühnen und Konzertsäle immer fremd geblieben. Sie war zu groß für einen Möbeltischler aus Ankara. Kadir steigt die Treppen hinunter in den Keller mit den Maschinen und den verstaubten Instrumenten, von denen einige schon so lange darauf warten, dass der Meister endlich Hand an sie legt und sie wieder zum Leben erweckt. Zum Klingen bringt. 

|