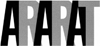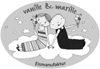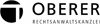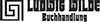Dezember 2024 - Ausgabe 265
Straßen, Häuser, Höfe
|
Die Schöneberger Straße 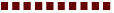
von Werner von Westhafen |
|
|

Den Namen Schöneberg gibt es schon lange, und er ist weit verbreitet, von Bayern bis hinauf an die Küsten. Auch in der Nähe Berlins gab es ein Dörfchen mit dem Namen Schöneberg. Es wurde eines Tages von der Stadt geschluckt, die sich maßlos ausdehnte, unüberschaubar und unbeherrschbar wurde, so dass sie in mehrere kleinere Unterstädte geteilt werden musste. Viele dieser Stadtbezirke erhielten ihre Namen von jenen Dörfern, die an ihrer Stelle einst noch zwischen Feldern und Wiesen gelegen hatten und nur durch wenige Straßen miteinander verbunden waren. Sie trugen nicht selten den Namen der Ortschaft, in die sie führten. So kam auch die Schöneberger Straße in Kreuzberg zu ihrem Namen. Doch es führen viele Wege nach Schöneberg, weshalb es gleich drei Schöneberger Straßen in der Stadt gibt: eine kurze Schöneberger Straße im entfernten Steglitz mit den Hausnummern 1–16, die den Walter Schreiber Platz mit der Feuerbachstraße verbindet und eher von Westen nach Osten führt als von Süden nach Norden; eine Schöneberger Straße zwischen dem historischen Dorfkern Alt-Tempelhof und dem heute sechsspurigen Sachsendamm in Schöneberg. Diese Straße erreicht immerhin schon die Hausnummer 36, wobei sie allerdings erst mit der 4 beginnt und also eigentlich nur 32 Häuser lang ist. Bis 1902 hieß die spätere Landstraße zwischen Tempelhof und Schöneberg noch Schöneberger Weg, dann allerdings wurde sie ausgebaut und zur »Straße« erhoben. Die älteste Schöneberger aber ist die Kreuzberger, obwohl sie heute mit ihren Nachwendebauten im ehemaligen Niemandsland zwischen Ost- und West so aussieht, als wäre sie gerade erst angelegt worden. Der ehemalige Feldweg, der 1827 über die Bullenwiese zwischen Feldern und Windmühlen von Berlin zum Botanischen Garten bei Neu Schöneberg führte, trägt den Namen seit 1843 und bringt es auf 24 Hausnummern. Heute beginnt die Straße im Norden bei der Ruine des Anhalter Bahnhofs, überquert auf der Schöneberger Brücke den Landwehrkanal und endet vor den Schienensträngen des Gleisdreiecks. Dabei lässt sie das einstige Dörfchen auf der Anhöhe beharrlich rechts liegen und verfehlt ihr eigentliches Ziel: Schöneberg. Was bedauernswert ist. Denn Schöneberg ist eine Reise wert! Schon seit der Steinzeit ist der »schöne Berg« bewohnt gewesen. Vom 1. bis zum 3. Jahrhundert lebten Semnonen auf dem Hügel, ein paar Jahrhunderte später ließen sich Germanen nieder und vermachten uns die Bronzefigur eines Rindviechs, das als »Schöneberger Rind« Karriere machte und heute im Museum steht. Wesentlich lebhafter wurde es bereits im 13. Jahrhundert, als immer mehr sächsische Händler und Kaufleute den Sachsendamm entlang in Richtung Ostsee zogen. Schon 1264 vermachte Markgraf Otto III aus Spandau dem an der neuen Handelsstraße gelegenen Benediktiner-Kloster »fünf Hufen in der villa sconenberch«. Hundert Jahre später gab es am »sconen Berch« immerhin schon 13 Bauernhöfe und einen Dorfkrug. Noch blieb es ruhig in der Gegend, man trieb die Kühe auf die Weide, ging aufs Feld, zeugte Kinder und saß abends im Krug, noch einmal einhundert oder zweihundert Jahre lang. Dann jedoch kaufte ein Kurfürst namens Joachim das komplette Dorf. 1656 entstand in der Nähe des Klosters ein Küchengarten für den fürstlichen Hof, der zum »Botanischen Garten« und einige Jahrunderte später zum »Heinrich von Kleist-Park« wurde. Da war auf dem Hügel längst kein Platz mehr für Bohnenkraut und Kerbel für die höfische Küche. Schon 1750 hatte Friedrich der Große zwanzig Flüchtlingsfamilien aus Böhmen gestattet, sich dort niederzulassen. Die neue Siedlung erhielt den Namen »Neu-Schöneberg«, und es dauerte keine fünfzig Jahre mehr, da entstand am Fuß des Berges die erste steingepflasterte Straße Preußens, die von Berlin nach Potsdam führte. Als 1838 auch eine Eisenbahn Berlin und die Königsstadt verband und in Schöneberg vor den Toren der großen Stadt Station machte, wurde der schöne Berg zum Ausflugsziel. Und nun dauerte es auch nicht mehr lange, da wurden aus den Bauern Gastwirte, Kaufleute und Immobilienhändler. Wiesen und Felder wurden immer weniger, Bauland dagegen immer mehr und immer mehr wert. 1898 erhielt Schöneberg das Stadtrecht, 1899 schied es aus dem Landkreis Teltow aus und bildete einen eigenen Stadtkreis mit 75 000 Einwohnern. Anstelle des alten Rathauses mit Gefängnis und Dorfschule trat ein stattliches Gebäude mit einem hübschen Glockenturm. Als das kleine Städtchen in den goldenen Zwanzigern gemeinsam mit Friedenau zum 11. Stadtbezirk Groß-Berlins wurde, lebten bereits 175.000 Berliner in Schöneberg. Doch nach den goldenen Zwanzigern kamen die braunen Vierziger. Das hübsche Rathaus aus dem 19. Jahrhundert wurde zerstört und nach dem Krieg durch einen eher schmucklosen Monumentalbau an ganz anderer Stelle ersetzt. Dennoch wurde das Schöneberger Rathaus mit seinem weithin sichtbaren Turm zum Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin erhoben und blieb bis zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten der Mittelpunkt des Berliner Politikgeschehens. Weltweite Berühmtheit aber erlangte der Name des einstigen Dorfes und späteren Städtchens erst am 26. Juni 1963, als der amerikanische Präsident John F. Kennedy die zerstörte und geteilte Stadt besuchte und den jubelnden Berlinern vom schönen Berg herunter zurief: »Ich bin ein Berliner.« |