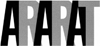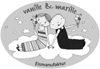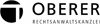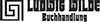Dezember 2024 - Ausgabe 265
 |
Kreuzberger
Sema Binia Man muss Fragen stellen 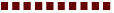
von Hans Korfmann
|
|
|
|
Sie hatte die Tür offengelassen. Nur einen kleinen Moment. Doch als sie zurückkam, fehlte der Rucksack. Darin, auf der kleinen Speicherplatte des Laptops, ihre gesamten Aufzeichnungen, Ideen für Bücher, Bilder, Musik, Projekte, die sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten. Die nie ausgeführt wurden, weil nie Zeit blieb, weil sie ein halbes Leben lang in Politikervorzimmern saß, telefonierte, sortierte, organisierte, Briefe schrieb, vierzig Stunden die Woche. »Alles weg! Genau wie damals. Ich hatte 48 Stunden Zeit, meine Sachen zu packen und das Land zu verlassen. Dabei hatte ich das Land gar nicht verlassen wollen. Am Samstag um 8 Uhr geht der Zug, hatte man mir gesagt. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt: Ich muss hier raus! Als meine Mutter eine Woche später in die Wohnung kam, um meine Sachen zu holen, war alles schon ausgeräumt.« Es hieß, es sei die Stasi gewesen. Aber warum? Die Frage beschäftigt sie noch heute. Es gab schon immer Fragen, die sie nicht losließen. Sema Binia muss eines dieser Kinder gewesen sein, das Erwachsenen Löcher in den Bauch fragt. Sie möchte den Sachen »auf den Grund gehen, weiterbohren«. Sie ist der Prototyp des Wissenschaftlers, Archäologen, Historikers. »Ich bin fünfundzwanzig Jahre lang mit dem Dampfer der Geschichtswerkstatt immer die gleiche Strecke gefahren. Alle paar Jahre gab es ein neues Thema. Und immer gab es Neues zu entdecken. Das ist total spannend.« Man muss Fragen stellen, um etwas zu erfahren. »Ich war gerade in die Schule gekommen und meine Urgroßmutter Margarete war bei uns. Ich weiß noch, wie ich zu ihr sagte: Erzähl doch mal von früher! Und sie dreht den Kopf zur Seite und sagt: Da gibt’s nichts zu erzählen.« Dabei war doch gerade die Welt der Erwachsenen, von der Kinder angeblich nichts verstanden, so geheimnisvoll. Die Erwachsenen erzählen nicht gern vom Krieg. Aber Sema fand heraus, dass ihre Großeltern im Hansaviertel in der Klopstockstraße gewohnt hatten. Dass Oma Gerda vor den Bomben aufs Land floh und nur ab und zu in Berlin war, um nach dem Rechten zu sehen. So auch am 22. November 1943. Die halbe Nacht stand sie mit den beiden Töchtern unter der Hansabrücke, während rundherum alles in Flammen aufging. Von 343 Häusern blieben 70 übrig. Auch die Wohnung der Großeltern war ausgebombt. Sie fragten sich, wo wollen wir leben? »Diese Frage zieht sich anscheinend durch unsere komplette Familiengeschichte!« Als der Krieg endete, waren sie fünf in einer kleinen Wohnung in Lichtenberg. »Es war beengt.« Sema war bereits sieben Jahre alt, als sie mit der Mutter nach Biesdorf zog. Sema hat viel nachgefragt, aber auch die Mutter war keine große Erzählerin. »Über meinen Vater hat sie kaum gesprochen.« So blieben auch in dieser Geschichte Lücken. Lücken, die sie magisch anziehen. Sie möchte zum Beispiel unheimlich gerne wissen, wo und wann diese Liebesnacht stattfand, aus der sie hervorgegangen ist. »Ich mein´, wer weiß schon, wann und wo er gezeugt wurde… - ist eigentlich auch egal! Aber ich bin am 13. Juni 1962 geboren. Genau zehn Monate nach dem Mauerbau! Wo haben die sich getroffen? Im Osten? Im Westen? Wie kamen sie über die Grenze?« Erzählt hat die Mutter, dass sie am 12. August 1961 in Friedenau war und mit der vorletzten S-Bahn zurück in den Osten gefahren ist. Dann wurde der Eiserne Vorhang zugezogen. Erzählt hat sie, dass ihr Vater an der Freien Universität in Westberlin Architektur studierte und am 12. August in Friedenau geblieben war. »Die standen vor derselben Frage wie 1943 meine Großeltern: Wo wollen wir leben?« Als die Mutter starb, fand Sema die Briefe, die sich die Eltern geschrieben hatten, von 1961 bis 1968. Noch aus der Türkei schrieb ihr Vater: »Ich komm´ nach Ostberlin… Wir gehen nach Westberlin… Wir können auch nach Antalya ziehn…« 
Sie saßen im Flugzeug mit den Briefen auf dem Schoß und nicht viel mehr Hinweisen als dem Namen eines Mannes, der vor vierzig Jahren in Deutschland gelebt hatte. Zurück in Berlin erzählte Sema Binia ihrer türkischen Kollegin von den Briefen und fragte, ob sie nicht einmal in Istanbul anrufen könne. Die Familie ihres Vaters komme aus der Politik. »Ich rufe mal meine Oma an,« lachte die Türkin, »die kennt jemanden im türkischen Abgeordnetenhaus.« Es dauerte keine fünf Minuten, da klingelte das Telefon. Zwei Jahre nach der Reise mit der Tochter saß Sema in Ankara in einem türkischen Restaurant und wartete auf Mithat Sirmen, einen Großcousin. Kaum hatte der das Lokal betreten und sich gesetzt, standen sechs Kellner um den Tisch herum, verbeugten sich und fragten nach den Wünschen. Später kam Ayshe hinzu, Mithats Frau, mit einem Stapel von Fotoalben, »höher als sie selbst!« Sema sah Gesichter, die ihr seltsam vertraut vorkamen. Sie wiederum zeigte der Familie die Briefe. Und erfuhr, dass Resats ältester Bruder, also ihr Onkel, Justizminister gewesen war, dass Mithat Sirmen ein bekannter Journalist und Fernsehmoderator war und dass die ganze Familie im Ausland studiert und es zu etwas gebracht hätte. Bis auf Resat. Der war nach 15 Jahren an der Freien Universität ohne Abschluss heimgekehrt. Auch Sema hat keinen Doktortitel erworben. Sie fühlte sich wohl bei ihrer Mutter in Biesdorf. Sie war 22, als ein Freund meinte, da stünde eine Wohnung leer in Prenzlauer Berg, sie müsse endlich mal raus aus Biesdorf. »Also bin ich da eingezogen.« Eines Tages klingelt es und eine Frau von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft fragt, ob sie hier wohne. Sema nickt und hat schon einen roten Kopf, da sagt die Frau: »Na, dann kommen Sie mal ins Büro, wir machen einen Vertrag!« Das eigene Leben begann. Sema besuchte die Abendschule und hätte gerne studiert, »wahrscheinlich Geschichte.« Um den Dingen auf den Grund zu gehen. Um nachfragen zu können. Aber dazu kam es nie. Eines Abends auf dem Heimweg sprach sie jemand an, in der Gegend gebe es Leute, die rechte Parolen in die Treppenhäuser schmierten. Sie solle doch mal die Augen offen halten. Als sie sich wiedertrafen, begann er, sie auszufragen. »Da dachte ich mir, ich dreh den Spieß einfach mal um und frage den über meine Freunde aus. Ich wollte wissen, was der schon wusste und wie die Stasi so funktioniert.« Man muss Fragen stellen. »Aber das ging total in die Hose, das wurden ganz absurde Gespräche! Und irgendwann erzählt mir eine Freundin aus der Abendschule, dass einer von der Stasi dagewesen wäre, so ein Typ mit Trenchcoat und Halbglatze. Heise oder so ähnlich.« Beim nächsten Kaffee mit dem Mann im Trenchcoat sagte Sema, sie habe keine Lust auf weitere Gespräche, er frage sie ständig aus und sie wisse nicht einmal seinen Namen. Er sagte, er heiße Heise. Sie traf ihn nie wieder. Dafür klingelte irgendwann eine Arbeitskollegin an ihrer Tür, Sema hätte da einen Termin bei der Stasi. Die Kollegin kam noch öfter, immer mit derselben Nachricht. »Richtige Verhöre waren das nicht. Aber Gespräche waren es auch nicht.« Warum Sema schon damals ins Visier der Staatssicherheit geriet, ist eine der vielen offenen Fragen. Denn die Sache mit Dieter, dem Freund aus Kreuzberg, kam ja erst später. Auch der Neuen Arbeits-gruppe für Staatsbürgerschaftsrechte, die auf eine Verordnung aus Alliiertenzeiten gestoßen war, die eigentlich jedem Berliner das Recht auf eine freie Wahl des Wohnortes zusicherte, egal ob im Osten oder im Westen, trat Sema Binia erst später bei. »Von dem Recht auf freie Wohnungswahl hatte ich immer nur gehört, nie etwas gelesen.« Aber jetzt war Sema schwanger. Von Dieter. Jetzt stand auch sie vor der Frage: Wo wollen wir leben? Also ist sie auf dem Amt gewesen und hat nachgefragt, wo oder wie sie mit Dieter zusammenleben könne. Die Frau jenseits des Schreibtisches sah sie verdutzt an und sagte, sie müsse einen Ausreiseantrag stellen. »Ich will aber gar nicht ausreisen. Ich will nur eine Familie gründen.« Von einem Recht auf freie Wohnungswahl hatte man auf dem Amt nie gehört. Drei Mal pendelte Sema Binia zwischen der Rechtsberatung und dem Magistrat hin und her. Fragte nach. Bohrte. Insistierte. Vergeblich. Eines Abends - sie wartete auf Dieter - klingelte es an ihrer Tür. Zwei Männer erklärten, dass Dieter heute nicht komme. Man habe ihn an der Grenze zurückgewiesen. Und dann stand auch ihre Kollegin wieder vor der Tür und überbrachte die übliche Nachricht: »Du hast einen Termin bei der Stasi.« - »Nee, ich habe keine Lust mehr.« – »Doch, du musst hin. Ich glaube, es geht um Deine Ausreise.« Und dann sagte man ihr, sie habe noch genau 48 Stunden, um das Land zu verlassen. Am Samstag, den 5. Februar 1988 um 8 Uhr, stand sie, im 7. Monat schwanger, auf dem Bahnhof in Schönefeld und traf eine Bekannte aus der Bürgerrechtsgruppe. »Was machst du denn hier?« – »Ich bin ausgewiesen worden!« – »Ich auch!« Als sie bei Helmstedt die Grenze überquerten, hörten sie vorne im Zug knallen. »Ich gehe mal nachsehen, was da los ist«, sagte Sema. Da saßen noch andere aus ihrer Gruppe und öffneten Sektflaschen. Der Zug nach Gießen war nicht der einzige, es gab noch zwei weitere Züge nach Westdeutschland, und in jedem dieser Züge saßen Mitglieder der Arbeitsgruppe. Dazu diejenigen, die auf der alternativen Luxemburg-Demo das Transparent mit dem berühmten Zitat hochgehalten hatten: »Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.« Drei Tage später klingelte Sema Binia an der Tür einer Kreuzberger WG am Südstern. Ralph öffnete und sagte: »Dieter ist nicht da, der ist Blumen holen.« Dieter hatte sie viel später erwartet. Sema wohnt heute noch in dieser Wohnung, aber die Studenten sind schon lange ausgezogen. Auch Dieter. Seit vielen Jahren wohnt Sema Binia nun mit einem Musiker dort, dem Bassisten einer Westberliner Politrockband, deren Sänger Rio Reiser 1988 in der rappelvollen Seelenbinderhalle in Ostberlin auftrat und ein Lied sang, das mit den Worten endete: »Dieses Land ist es nicht…« Geschichte hat Sema Binia auch im Westen nicht studiert. Sie war erst einmal Mutter. Aber dann erwähnte einer von Dieters Kommilitonen die Geschichtswerkstatt, das sei das Richtige für sie: »Du fährst mit dem Dampfer durch Berlin und erzählst.« Auch die Frau auf dem Arbeitsamt hatte das Talent der jungen Mutter erkannt: »Für Sie habe ich etwas ganz Besonderes: Ein Praktikum in der Geschichtswerkstatt!« Sema grinst: »Da ging offensichtlich kein Weg dran vorbei!« 25 Jahre fuhr sie mit dem Dampfer durch Ost und West und erzählte aus der Geschichte Berlins. Jetzt geht sie nur noch zweimal im Jahr an Bord, um die Geschichte der Scherben zu erzählen. Während der Bassist, den sie geheiratet hat, unter Deck Lieder von Rio Reiser anstimmt: Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei, du warst hier, und wir war´n frei... Im nächsten August werden sie es wieder singen. Ein paar Jahre sind es noch, dann wird Sema ihren Vorzimmer-posten in den Büros verlassen und Zeit haben, um ihre vielen Ideen und Projekte zu verwirklichen. Die Frage, wo sie leben soll, hat sich nicht mehr gestellt. Doch der Musiker hat ein kleines Haus geerbt, nicht weit von der See. Es ist schön dort… |