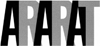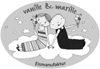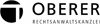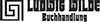Dezember 2024 - Ausgabe 265
Geschichten, Geschichte, Gerüchte
|
Die alten Kreuzberger Volksfeste (3): Von der Breiten Straße bis zum Schloss 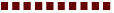
von Werner von Westhafen |
|
|

Einer der beliebtesten und größten Berliner Jahrmärkte fand nicht wie die meisten anderen Feste im Sommer, sondern mitten im Winter statt: Das war der Berliner Weihnachtsmarkt, der sich einst mit bis zu 700 Buden vom Landwehrkanal bis zum Schlossplatz hinzog. Der Weihnachtsmarkt war, wie Ingrid Heinrich Jost in ihrem Buch über Berliner Rummelplätze schrieb, »der krönende Abschluss des Volksfestjahres.« Historische Weihnachtsmärkte gibt es heute in ganz Deutschland. So auch auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain, das mit Fackeln und Feuerstellen, Töpfern und Schmieden und in mittelalterlicher Sprache mit »manch leckerem Trunk« lockt. Der Markt will eine Alternative zu den großen Weihnachtsveranstaltungen in der Stadtmitte sein. Doch schon 1926 hielt ein weihnachtlicher Berlinbesucher in seinem Tagebuch fest, dass es nur noch geschmückte Ladengeschäfte und leerstehende Bauplätze gäbe, kaum noch Buden und Karussells. Er schrieb: »Wer noch etwas vom Weihnachtsmarkt sehen will, der muss nach den Vororten ziehen, nach Schöneberg« oder in die Tempelhofer Vorstadt am Kreuzberg. Da höre man noch den Waldteufel und könne die Laufende Maus sehen. Die große Zeit der Weihnachtsmärkte war vorüber. Schon 1897 kommentierte die Zeitschrift Komet: »Der Weihnachtsmarkthandel teilt das Schicksal des Kleinhandels«, der gegenüber den modernen, großen Warenhäusern »ins Hintertreffen geraten ist und kaum noch so viel abwirft, dass der Budenbesitzer einen Überschuss behält. Der poetische Zauber, der einst den Berliner Weihnachtsmarkt umgab«, sei verloren. Der Berliner Satiriker und Revolutionsschriftsteller Adolf Glasbrenner sah bereits um 1848 nur noch wenig Zauberhaftes, wenn er die fluchenden Markthändler zitierte: »Kotz! Schock! Schwerebrett, is det wieder´n Weihnachtsmarcht, da möchte man die Platze vor Ärger kriegen, Madame Piesichen. Nun seh´n Se mal, nu steht so´n unjlücklicher Mensch hier wie ick un trampelt und schlägt sich die Kälte aus´m Leibe, un warum? Um nischt, reene um nischt! Oder nennen Sie das was, Piesichen, dass ich heute seit um Zehne drei Pfeifen zu sechs Silbergroschen, zwei Spitzen un een Wassersack verkooft habe? Is det die Miete wert?« Der Berliner Schriftsteller und Regisseur Felix Philippi erinnerte sich in seinen bereits 1913 erschienenen Jugenderinnerungen voller Sehnsucht an »das alte Berlin« und versuchte die Stimmung vergangener Zeiten heraufzubeschwören, indem er diese vielen phan-tastischen Dinge aufzählte, die von den Händlern auf den Märkten lauthals angeboten wurden: »Welche Herrlichkeiten! Potztausend, davon haben Sie ja gar keine Ahnung: Leinwand aus Schlesien und Schaftstiefel aus Kalau, Puppen mit blödsinnigen Gesichtern und einhenklige Porzellanvasen zu intimen Zwecken, klug karierte Bettbezüge und taubstumme Kanarienvögel, Seife, die nach Heringen roch und Heringe, die nach Seife schmeckten, und feinsten französischen Rotwein - darauf kann ich Ihnen mein Ehrenwort geben - Bordeaux Schloßabzug, die Flaschen 7 Silbergroschen... Und dann die vielen hundert Spielzeugbuden, die mit ihren Festungen, Wachen, Zinnsoldaten, mit den Puppenstuben und Küchen die Jugend in den Taumel des Entzückens vesetzten, und die Pfefferküchler! All die Berge von Mehlweißchen und Pflastersteinen, von Pfeffernüssen und Zuckerherzen, von vergoldeten Äpfeln und versilberten Nüssen, von rosa gefärbten Honigkuchen, die in weißer Zuckergußschrift sinnige Lehrsprüche und innige Liebe in nicht ganz einwandfreier Orthographie kündeten. Und dieser Höllenlärm von Knarren und Mähschäfchen, von quietschenden Puppen, von Trompeten, Trommeln und Drehorgeln....« Der Besuch des Weihnachtsmarktes war kein Einkaufsbummel, sondern ein Jahrmarkts-Vergnügen und ein Erlebnis. Man amüsierte sich über die Laufende Maus auf Rädern und über den Mann, der Uhren mit einer Garantieurkunde verkaufte, auf der stand: »Wenn se jeht, dann jeht se, und wenn se steht, dann steht se!« Seit dem 15. Jahrhundert gab es in Berlin den Markt der Honigkuchenbäcker, im 17. Jahrhundert waren es bereits mehr als 50 Buden auf der Breiten Straße, von wo aus sich der Markt über die Gertraudenstraße und den Fischmarkt allmählich bis zum Schloss vorarbeitete. Das Ende nahte 1873, als man den Weihnachtsmarkt in den Lustgarten verlegte und von dort in die Alexandrinenstraße, wo erste Karussells und ein »oberbayrisches Ball-werfen« für Unterhaltung sorgten, wo es eine »Damenkapelle« und »Otto Schmidts Riesenknaben« zu bestaunen gab. Der Berliner Wortwitz aber ging mit der Zeit verloren. Heute steht auf den weihnachtlichen Lebkuchenherzen nur noch ein einfallsloses I love you. Auf dem Weihnachtsmarkt des 19. Jahrhunderts konnte so ein Lebkuchenherz noch zum Verkaufsschlager werden. Besonders beliebt bei den Männern war ein Lebkuchenherz, mit dem sie jeder Angebeteten garantiert ein Lächeln abgewannen. Mit weißer, marmorharter und unvergänglicher Zuckerglasur war darauf geschrieben: Ick musste dieses Herz Dir koofen; Ick dachte an Dir immerzu. In meinem Zimmer rußt der Ofen, In meinem Herzen ruhst nur Du!« |