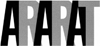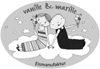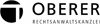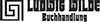Juni 2001 - Ausgabe 28
Literatur
|
Die 4. Lange Buchnacht in der Oranienstraße« 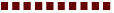
von Hans Korfmann |
|
|
|
Noch immer assoziiert man mit Büchern gemütliche Schaukelstühle vor dem heimischen Kamin und stille Stubenhocker mit Brillen auf der Nase. Daß die Literatur jedoch nicht nur Refugium im lauten Alltagsleben, nicht friedliche Insel im Chaos der Großstadt ist, demonstrieren die Kreuzberger Buchnächte. Selten zieht es so viele Besucher in die verrufene Demonstrationsmeile wie in der literarischen Sommernacht. Nur am 1. Mai, wenn Herr Werthebach wahre Menschenheere hier zusammentreibt, ist mehr Leben und Bewegung in der Oranienstraße. Längst ist der abendliche Spaziergang durch Kneipen und Cafés, durch Buchhandlungen und im Hinterhof angesiedelte Verlage, eine der besonderen Attraktivitäten der Stadt geworden. Ein Fest – nicht von oben diktiert und organisiert, sondern von unten gewachsen. Eine Initiative jener, die hier leben und arbeiten. Am 16. Juni drängen sich in den Buchhandlungen Leser und Zuhörer, keine Kneipe, in der nicht einer das Mikrofon und das Wort ergreifen würde. Schriftsteller und Dichter diskutieren und erzählen, man singt das Wort und man untermalt es, szenisch, graphisch, musikalisch. Die Verlage haben ihre Türen geöffnet und berichten über ihre Arbeit, und die Evangelische Kirchengemeinde St. Jacobi-Luisenstadt schlägt »Ein neues Kapitel im Buch der Kirchengeschichte auf« und berichtet über den »Ostarbeitereinsatz« auf kirchlichen Friedhöfen in Berlin zwischen 1942-1945. Obwohl auch hier das Wort zum Verkauf ausliegt und es im Hof des Kreuzberg Museums einen Büchermarkt mit vermeintlichen Raritäten gibt – so wie die letzten Exemplare der »Kreuzberger Chronik« des 1. Jahrgangs – wird die O-Straße nicht zum verlängerten Verkaufsregal. Es geht um die komplette Welt des Buches, um die Entstehung und die vielfältige Verbreitung des geschriebenen Wortes. Nicht um das große Geschäft, im Gegenteil: »Hilfe, der Vertreter kommt!« – so der Titel einer Veranstaltung in der Buchhandlung »Dante Connection«, die den skurrilen Weg vom Manuskript zum Buch und vom Buch in die Auslagen beschreibt. In Kreuzberg präsentieren sich nicht die großen, sondern die kleinen Verlage und literarischen Außenseiterprojekte. Der Frauenverlag Orlanda oder der Quer-Verlag tragen Erotisches zur Nacht bei. Liebhaberdruckereien wie Hugo Hoffmann und die Berliner Handpresse stellen ihre Projekte und verschiedene Drucktechniken vor. Zumindest »Klaus Wagenbachs Stimme« wird anwesend sein, wenn der Kinderbuchillustrator Axel Scheffler am frühen Nachmittag dem literarischen Nachwuchs Stifte und Papier in die Hand drückt, um Bilder zu den italienischen Geschichten »für große und kleine Kinder« zu malen. Im »oh 21« zeigt Harun Farocki seinen »Tag aus dem Leben der Endverbraucher« – einen Film, zusammengeschnitten aus bekannten Werbebildern. Im »Sunugaal« wird erst nachts um halb Eins das »Literarische Sondereinsatzkommando« aktiv und liest Texte von Morgenstern, Wedekind und Ringelnatz. Und um 1 Uhr betritt Rachelina mit ihren beschwichtigenden italienischen Serenaden die Szene und betört ihre Zuhörer mit Charme und Stimme. Das Wort nimmt viele Formen an in dieser Nacht – es gehört nicht mehr den Autoren allein. Vor allem gehört es keinen Fremden. Wer hier liest, ist in der Regel auch von hier. Das »Anti-Quariat« hat um 16 Uhr drei Berliner »K«s in den »Goldenen Hahn« geladen: Kapielski, Krampitz und Kramer. Ein vierter K liest in der Bona Peiser Bibliothek: Wladimir Kaminer erzählt von der »Russendisko«. Im Kreuzberg Museum läßt es sich eine amerikanische Autorin nicht nehmen, etwas über ein Dorf in Brandenburg zu erzählen: »Was sagt das linke Knie zum rechten?« Damit zeigt die Kreuzberger Buchnacht mehr als die größte Buchmesse der Welt: die Frankfurter Buchmesse. Denn sie zeigt nicht nur die Helden der Literatur: Autoren und Kritiker. Sie zeigt alle, die am Buch mitarbeiten. Im Hintergrund. |